Taxi zum Klo – Kritik
Neu auf VoD: Lehrer Ripploh sucht nach einem gangbaren Leben zwischen Schule und Klappe. Taxi zum Klo, Schlüsselfilm fürs Queer Cinema, Konfrontation fürs Heteropublikum und vielleicht das erste Meisterwerk des deutschen Kinos der 1980er Jahre.

„Manchmal denke ich über einen kommerziellen Spielfilm über Schwule nach: eine Liebesgeschichte zweier Männer, die den schwulen Kitsch, aber auch die Bemühungen um Emanzipation beschreibt.“ Fünf Jahre nach Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt (1971) beklagte Rosa von Praunheim das Ausbleiben neuer Filme, die den Homosexuellen abseits eines Spannungsfeldes zwischen Leder und Travestie zeigen. Erst vier Jahre später sollte der Berliner Hauptschullehrer Frank Ripploh, damals ein guter Bekannter des Filmemachers, dieser Idee nachkommen: Taxi zum Klo (1980) erzählt genau jene Liebesgeschichte, die von Praunheim vorgeschwebt hatte. Das „erste Meisterwerk des deutschen Kinos der achtziger Jahre“ hatte der Kritiker Hans C. Blumenberg damals Rudolf Thomes Berlin Chamissoplatz (1980) genannt – die Bezeichnung hätte auch Ripplohs Film verdient, der Bestandsaufnahme und Utopie zugleich sein will.
Streifzüge in fremde Welten

Der Regisseur und Hauptdarsteller inszeniert in Taxi zum Klo gemeinsam mit Co-Produzent und Kameramann Horst Schier den – autobiografisch gefärbten – Alltag des Lehrers Ripploh. Der sucht zwischen Schule und Klappe, Kegelabend und Tuntenball nach einem gangbaren Leben, auch um das eigene Verständnis von Normalität zu erkunden und immer wieder neu auszuhandeln. Zugleich richtet sich Ripploh im Voice-over bereits in den ersten Minuten an ein Publikum, dem die Welt, die sich nun entfalten soll, als eine fremde präsentiert wird.

Zumindest scheint es für einen kurzen Moment so: Ripplohs frivole Feststellung (und nicht Frage), dass (und nicht ob) die Zuschauenden ihn nun auf seine Streifzügen begleiten wollen, wird vom Film zunächst unterstrichen (die Vaseline auf dem Nachttisch, der blanke Hintern des Protagonisten im Blick der Kamera). Doch kurz darauf entzieht sich Taxi zum Klo diesem exotisierenden Blick auf die eigene Subkultur schon wieder: Ripploh stolpert nunmehr schlaftrunken durch seine Berliner Altbauwohnung, um der Nachbarin die Zeitung aus dem Türbriefkasten zu stehlen; Bilder, wie sie dem bundesdeutschen Berlin-Film jener Zeit nicht fremd sind.
Leitmotiv in rotem Plastik
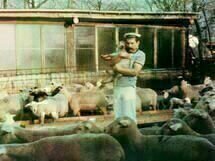
Ripploh folgt diesem Programm dann auch weiterhin: Die Momente und Orte homosexueller Subkultur der frühen 1980er Jahre bilden hier eben keine Parallelwelt zu einem anderen Leben, das der Film als spießbürgerlich andeutet; Taxi zum Klo begreift sie vielmehr als Teil ein und derselben Welt. Ein frühes Leitmotiv sind hier die Diktathefte des Lehrers; ein in rotes Plastik eingebundenes Bindeglied zwischen den einzelnen Stationen der Erkundung, auf die wir eingeladen wurden. Auf dem Küchentisch korrigiert Frank neben Kaffee und Brötchen letzte Sätze, an der Tankstelle schreibt er die Nummer eines ihn offen interessierenden Tankwarts auf ein Löschblatt. Schließlich bleiben die Hefte auf dem verdreckten Boden der öffentlichen Toilette liegen, während ein erigierter Penis durch das Glory Hole der anliegenden Kabine gedrückt wird.

Gerade Letzteres, die audiovisuellen Bilder gleichgeschlechtlicher Sexualität, nimmt in Taxi zum Klo eine zentrale Rolle ein. Zunächst festigt das den Ruf des Films als Schlüsselfilm des Queer Cinema, bot er doch Bilder an, die zu Beginn der 1980er Jahre noch gesucht werden mussten, wenn es darum ging, eine Idee der eigenen (Homo-)Sexualität zu erhaschen. Ripplohs Film war alles andere als Mainstream und durch seine Produktionsgeschichte, den Stab und die Inszenierung fest mit dem West-Berliner Avantgarde- und Undergroundfilm verbunden. Heterosexuelle Kinogänger konfrontierte Taxi zum Klo mit einem Anderen, dessen vermeintliche Fremdheit jedoch rasch durch die Einbettung der Szenen in die Geschichte – und damit immer auch in die Inszenierung – des Films zurückgenommen wird.
Einer puzzelt, der andere wirft sich in Leder

Die Suchbewegung des Protagonisten wird dort besonders gekonnt in Szene gesetzt, wo Ripploh sich selbst im Auto zeigt, im Regen über die im bunten Licht beleuchteten Straßen von Berlin fährt und die Zuschauenden durch inneren Monolog an seinem persönlichen Entweder-Oder teilhaben lässt. Es ist die Beziehung zu Bernd (Bernd Broaderup), den er zu Beginn des Films in einem Kino kennengelernt hat und in den er sich rasch verliebte, die ihn unruhig werden lässt. Bernd, der eine Sehnsucht nach Häuslichkeit in sich trägt, vom Bauernhof auf dem Land träumt und dem Partner abends das Essen an den Tisch serviert, wird nach und nach zum Moment der Unsicherheit in Franks Leben. Darf er sich dieser Zweisamkeit hingeben, oder ist der Drang rauszugehen, zu erobern und ständig das Neue zu erleben, größer als die Versprechen der Stabilität?

Wo der Film zunächst noch versucht, seine Geschichte in einem gemeinsamen Erfahrungshorizont (eben dem West-Berlins) stattfinden zu lassen, brechen ihre beiden Welten mehr und mehr auseinander, findet hier tatsächlich eine Parallelmontage statt, die nicht die Welt der Homosexuellen von jener der Heterosexuellen trennt, sondern die von Bernd und Frank. Während der eine puzzelt, wirft sich der andere in Leder, während der eine noch krank aus dem Bett heraus mit dem Taxi wieder zur Klappe fährt, organisiert der andere im Reisebüro den gemeinsamen Urlaub.
„Können wir mehr als uns nur wiederholen?“

Taxi zum Klo endet mit einem letzten Eklat, als Frank es auch auf dem alljährlichen Berliner Tuntenball nicht gelingt, seine Aufmerksamkeit auf den Freund statt auf einen eben erst kennengelernten Stallburschen zu lenken. Verkleidet als orientalische Bauchtänzerin (Frank, immer noch mit Bart) und Matrose (Bernd, den es eben in die Ferne zieht), trennen sie sich nach einer kurzen gemeinsamen Fahrt in der Linie 1. So endet der Film – nach einem letzten Moment im Unterricht, in dem Frank direkt von der U-Bahn aus im vollen Kostüm den Klassenraum aufsucht – mit einem Blick in den Spiegel und einem Voice-over, das Frank beim Abschminken zeigt. Es noch einmal versuchen oder sich umbringen? Das eine doch eine Option und das andere zu melodramatisch?

„Können wir mehr als uns nur wiederholen?“, fragt Frank, fragt Ripploh am Ende. Und das Publikum kann diesen Satz mitnehmen, für den Film, das eigene Leben oder als Leitlinie der Filmgeschichte. Denn Ripploh wiederholte sich nicht. Seine anschließenden und letzten beiden Spielfilme, bevor er in den 1990er Jahren in die Produktion von Pornofilmen einstieg, Miko – Aus der Gosse zu den Sternen (1986) und Taxi nach Kairo (1987), wurden als Verrat an der Szene gesehen. Aids, der „Schuss ins stille Glück“ (Stefan Hinz) war in ihnen kein Thema, die Entscheidung eher für ein Kino gefallen, das den bundesdeutschen Film der 1980er Jahre in Verruf brachte. Die Entscheidung, die Ripploh in Taxi zum Klo noch offen gehalten hatte, wurde in ihnen zugunsten des Biedermeiers gefällt, der in seinem Debütfilm nur eine Option von vielen darstellte.
Den Film kann man sich gerade für 4,90 Euro im Salzgeber Club ansehen.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Taxi zum Klo“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (16 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.
















