Wenn das Licht zerbricht – Kritik
Als ein Student stirbt, trauern seine Freunde – und heimlich auch seine Geliebte. Rúnar Rúnarssons Wenn das Licht zerbricht erzählt vom schlecht abgestimmten Trauern in der Gruppe und spielt geschickt mit dem Wissensgefälle der Figuren.

Una (Elín Hall) und Diddi (Baldur Einarsson) sind frisch verliebt. Frisch genug, dass sie noch keine Zahnbürste bei ihm deponiert hat; verliebt genug, dass ohnehin eine genügt. Und wiederum derart frisch, dass Diddis offizielle Freundin Klara (Katla Njálsdóttir) fernbeziehungsbedingt noch nichts weiß von dem neuen Glück ihres Freundes. Morgen soll sich das ändern: Diddi wird mit Klara Schluss machen und die Liebe zu Una nicht länger verheimlichen. Dem gemeinsamen Glück wird nichts mehr im Weg stehen. Gemeinsam betrachten sie den Sonnenuntergang, allein schon der Metapher wegen: Der Horizont fern, aber fest im Blick, dazwischen der Ozean, auszuschöpfendes Potenzial. Die letzten Strahlen versprechen eine rosige Zukunft.
Nur halten sie ihr Versprechen nicht. Denn am Morgen kommt alles anders. Diddi gerät in ein verheerendes Tunnelunglück. Bevor er die Beziehung beenden kann, beendet der Unfall sein Leben. Die letzten Strahlen, die er aus dem Auto heraus zu sehen bekommt, sind vorbeiziehende LED-Deckenleuchten; das Licht am Ende des Tunnels entpuppt sich als gewaltig heranrollende Feuerwolke, die verzehrt, was ihr in den Weg kommt – Kamera (Sophia Olsson) inklusive. Mit unaufgeregter Bestimmtheit schlägt das Unheil in den Prolog ein, fast sakral legt sich Jóhann Jóhannssons Ambient-Lacrimosa Odi et Amo über die Tunnelsequenz. Wenn das Licht zerbricht, dann richtig. Rúnar Rúnarssons Film macht sich daran, die Scherben aufzulesen. Trauern – aber wie?
Emotionsentgleisung im Anschlag
Die Medien sprechen von einer nationalen Tragödie, die (isländischen) Fahnen hängen auf Halbmast. Wenn das Licht zerbricht kann auf Staatstrauerpathos verzichten, das private Unglück ist tragisch genug und für Una doppelt kompliziert: Sie verliert einen geliebten Menschen und niemand weiß, niemand darf wissen, dass es ihr geliebtester war. Dass er mehr für sie war als Bandkollege und Kommilitone im Bachelor Performance Art an der Kunstuniversität Reykjavík.

Als Diddis bester Freund Gunni (Mikael Kaaber) aufgewühlt in der Uni aufkreuzt und den Verdacht äußert, Diddi könnte unter den Unfallopfern sein, nimmt Una notgedrungen die Rolle der Tröstenden ein, bewahrt die Fassung, zumindest nach außen hin. Ihr Gesicht zwar kontrolliert und stumpf, aber mit Emotionsentgleisung im Anschlag und immer mindestens einer Träne in den fjordblauen Augen. Diddis Freunde, die Una teils gar nicht kennt, trudeln nach und nach ein; man verschränkt die Leiber zu Gruppenumarmungen, die Halt geben sollen, wo es keinen mehr gibt. Una bleibt meist außen vor, die Kamera eng bei ihr, dringt aber nie zu ihr durch, taxiert sie stattdessen immer wieder durch kühl-vermittelnde Glasfronten.
Rauchen und Saufen als trotzig verrichtete Trauerarbeit
Als die Gewissheit einbricht, dass Diddi tot ist, bekommt Una das nur aus der Halbdistanz mit. Sie haut erstmal ab, es ist ihr alles zu viel. Ihr Vater disqualifiziert sich als Trostspender, als er unbeholfen fragt, seit wann sie denn rauche. Dann doch lieber zurück zu den Peers in die Kneipe, wo Rauchen und Saufen wenigstens keine moralische Verurteilung erfährt, sondern als trotzig verrichtete Trauerarbeit gelten darf.
Die Trauerökonomie, in der Una samt ihrem Geheimnis navigieren muss, gewinnt an Suspense, als Klara zur Gruppe stößt. Die Doch-nicht-Ex zieht weitaus mehr Mitleid und Zuwendung auf sich als die Noch-nicht-Freundin. Wenn das Licht zerbricht spielt mit dem Wissensgefälle der Figuren und findet so raffinierte Wege, die komplexen Emotionen innerhalb der Gruppe aufzufächern. Plötzlich ist Una eifersüchtig – nicht auf Klara als Konkurrentin, sondern auf Klaras Tränen, die ungehemmt fließen dürfen, während ihr nicht mehr zusteht als wohltemperiert zu weinen.
Gen-Z-förmiges Feiern des Weiterlebens

Die Verdichtung der Handlung auf den Verlauf eines (polarsommergemäß: sehr langen) Tages, von einem Sonnenuntergang zum nächsten, sowie die diffizile Figurenkonstellation berühren eines der Grundprobleme des Trauerns in Gruppenzusammenhängen: Alle trauern, aber jede*r trauert anders. Die Bedürfnisse sind nicht deckungsgleich, die Phasen der Trauer schlecht synchronisiert. Und doch sucht man nach den gemeinschaftlichen Praktiken einer Trauergemeinde, so unzureichend sie für das einzelne Glied sein mögen.
Hier läuft das auf ein mehr oder weniger Gen-Z-förmiges Feiern des Weiterlebens hinaus: Man trinkt nicht besinnungslos, sondern „auf Diddi“, man raucht und vapet, man weint und lacht. Dieser Übereinkunft muss sich auch Una fügen. Zwischen ihr und Klara findet gerade wegen der seltsam nachträglichen Konkurrenzsituation eine Annäherung statt, die bis zum Schluss ambivalent bleibt und zwischendurch in einer schönen Verschmelzung der Gesichter per Glasreflektion mündet (erneut Licht, das bricht), was vielleicht als Persona-Referenz auszulegen ist.
Trotz der knappen Laufzeit trägt die vielversprechende Prämisse nicht über die gesamte Strecke, vielleicht weil das Drehbuch etwas zu geschrieben wirkt, die Form zu geglättet: Jede Klammer schließt sich, jede Kamerafahrt weiß, wohin sie will. Außerdem passieren Dinge, die in Filmen mit jungen Menschen und Cannes-Premierenhintergrund häufig passieren: es wird getanzt, und zwar betont transformativ. Unas Geheimnis droht sich zu lüften – aber die anderen heben sie auf, tanzen weiter, mit dem Schmerz gegen den Schmerz. Unangenehm tief in den Schmerz hineinbohren will Wenn das Licht zerbricht allerdings selten; die grotesken Einsprengsel (Uni-Absolvent*innen in ulkigen Ganzkörperkostümen im Bus) sind zwar erfrischend, gefallen sich aber ein bisschen zu sehr darin.

Manchmal hat der Humor seine Bewandtnis. An der Uni, noch bevor alles zerbricht, wohnt Una einer als Sozialexperiment angekündigten Performance bei, Thema: „Wie sich Menschen gegenseitig beeinflussen.“ Drei mit doppelseitigem Klebeband umwickelte Studentenkörper stehen im Dreieck, umarmen sich mit Nachdruck, bleiben aneinanderhaften, verlieren die Balance und landen unsanft auf dem Boden, wo sie käferähnlich mit den Gliedmaßen zappeln. Einerseits: lustig. Andererseits: ein treffendes Bild für die Unfähigkeit miteinander zu trauern. Die Suche nach Trost im Anderen wirft zu Boden, wo man ja sowieso schon war und vorerst auch bleiben wird. Aber nun halt: verbunden in Trauer, doppelseitig verklebt. Gemeinsam wird das Wiederaufstehen leichter fallen.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Wenn das Licht zerbricht“

Trailer ansehen (1)
Bilder



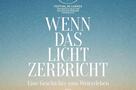
zur Galerie (6 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.








