Vor der Morgenröte – Kritik
Lehrer: Finger weg. Maria Schrader hat einen Historienfilm gedreht, der Stefan Zweig weder als Material für den Literatur- noch für den Geschichtsunterricht aufbereitet. Die Erfahrung der Vergangenheit, ein ästhetisches und ein erzählerisches Fest.

Es beginnt mit einer Zentralperspektive auf ein pompöses Bankett und endet mit einem mehrfach gebrochenen Bild im Spiegel einer geöffneten Schranktür: Maria Schrader gibt eine Richtung vor, um dem Leben von Stefan Zweig nachzuspüren. Es sind genauer genommen sechs Episoden aus seiner Zeit im Exil, die sie inszeniert, säuberlich getrennt mit Orts- und Zeitangaben, eingeblendet auf einem fast weißen Hintergrund, der Papier sein könnte. Äußerlich gibt sich Vor der Morgenröte zurückgenommen, doch das Ausschnitthafte entwickelt einen wundersamen Sog. Hinein in eine Zeit, die wir nicht gekannt haben, in ein Leben, das nur Erzählung sein kann, das unwirklich erscheint und doch von einer besonderen Dringlichkeit durchzogen ist. Mit Stefan Zweig durch Brasilien reisen, vor dem Krieg fliehen, die Heimat nie aus dem Kopf kriegen, ankommen ohne anzukommen. Die Vergangenheit wird zu einer Gegenwart, das liegt zunächst (aber nicht allein) an einer folgenschweren Entscheidung des Drehbuchs, das Schrader gemeinsam mit Jan Schomburg (Über uns das All, 2011) verfasst hat.
Von der Scham, anders zu sein

Statt Geschichte zu raffen, sie in Montagen und großen Erzählsträngen erfassen zu wollen, wird sie hier als Off behandelt, als etwas, das in der Erzählung keinen Platz finden kann, weil es dafür keinen menschlichen Zugang gibt. Das Vorher und Nachher, wir können es nur erinnern, extrapolieren, imaginieren. Weil Geschichte immer das ist, was wir persönlich nicht erfahren können, was eine übermenschliche oder eben historische Aufsicht verlangt. Völlig schlüssig erscheint die seltene Entscheidung, Geschichte in wenige, ausgewählte Augenblicke aufzufalten und die Perspektive so zu beschränken, dass der Film sich nicht für Schulklassen und bequeme Lehrer anbietet. So groß wie die Informationslücken sind, so feingliedrig ist die Aufmerksamkeit für das, was man Alltag nennen könnte, obwohl es den für Stefan Zweig nicht zu geben scheint. Exil heißt, nie zur Ruhe zu kommen. Vor der Morgenröte zeigt das besonders gut, wenn äußerlich Ruhe zu herrschen scheint. Aufregung, Anspannung, Begehren, selbst in dem entspanntesten Spaziergang liegt noch ein solcher Druck, dass das Zerrinnen der Zeit schmerzlich ist.

Josef Hader, den seine Auftritte als komödiantischer Darsteller perfekt vorbereitet haben auf diese körperbetonte Rolle des anwesend-abwesenden Starautors auf Reisen, steht in einer Szene hinter einem Busch. Zweig liest die Zeitung, im Stehen. Aus der Ferne wird er erkannt und tritt hervor. Er wirkt verloren, denn er hat sein Gegenüber noch nicht identifiziert. Er läuft ihm sanft, unerschrocken, aber auch etwas zögerlich entgegen. Hader gibt dem alternden Zweig eine Aufmerksamkeit und Präsenz, die sich ständig selbst im Weg steht, die Schärfe seiner Sinne leicht verdeckend, ob seiner Scham, anders zu sein, mehr zu sein, besser zu sein. Den Kopf stets ein wenig nach unten geneigt, hat Hader die bemühte Zurückhaltung in alle Bewegungen, Blicke und seinen Gang eingespeist, selbst dann noch, wenn der Autor alleine durch die Straßen läuft. In einer Szene, dem Schlüsselmoment der Privatheit, begrüßt er einen Hund und scheint voll in dieser Begegnung aufzugehen. Er wirkt gelöst, sein Kopf aber bleibt geneigt. Und er wird liebevoll dabei beobachtet.
Fremd bleiben als Bekenntnis

Beiläufig majestätisch, beiläufig entlarvend, beiläufig intim: Die Bilder des österreichischen Kameramanns Wolfgang Thaler drängen sich, ganz wie hier Zweig, gleichzeitig auf und entziehen sich dem Zugriff. Thaler, der für seine offensive Arbeit mit Ulrich Seidl und Michael Glawogger bekannt ist, stellt die Kompositionen immer wieder so aus, dass sie ihren Eigenwert bewahren, um sie dann in den Fluss der szenischen Bewegungsabfolge doch aufgehen zu lassen. Der Entfremdungseffekt begreift die Unfähigkeit von Zweig, seinem Umfeld zu geben, was es von ihm erwartet, etwa die Verurteilung des Naziregimes aus der Ferne oder den sich gerne hofieren lassenden Gast. Die Entfremdung ist aber auch deshalb Methode, weil Zweig filmisch fremd bleiben muss und der Blick hinter die Kulissen seiner Auftritte, Pressegespräche und Publikationen der Geschichte keine Geheimnisse entlocken wird. Die Wahrheit nämlich, sie liegt völlig offen in diesem Film, sie ist einfach da, als Moment, als Erfahrung, als Bekenntnis zu Aufmerksamkeit und Zurückhaltung. Der Spiegel in der Schranktür, der sich am Ende so wendet, dass er fast die Kameralinse auf sich selbst zurückwirft, lässt mich hochschrecken. Das wirkt auch nach der Morgenröte weiter.
Neue Kritiken

Primate

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail
Trailer zu „Vor der Morgenröte“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (21 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Elrune Fortmann
Chapeau - mon cher. Trefflich formuliert!
Martina Reichert
Zweifelsohne, eine Sternstunde des deutschen Films, hier ist in gelungener Stille, unaufgeregt, aber doch sehr eindringlich, ein trauriges Kapitel deutscher Geschichte erzählt worden, am Beispiel von Stefan Zweig.
Ich bin beeindruckt und kann diesen Film nur empfehlen !













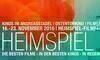



2 Kommentare