Triangle of Sadness – Kritik
VoD: Die Reichen und Schönen räkeln sich an Deck eines Kreuzfahrtschiffs, allesamt unsympathisch und ein bisschen dumm. Kopfschüttelnd schaut Ruben Östlund ihnen in seiner Satire Triangle of Sadness zu und lächelt in sich hinein.

Carl (Harris Dickinson) ist ein dürftig beschäftigtes Model und der Insta-Boyfriend der Influencerin Yaya (Charlbi Dean Kriek), soll heißen, er fotografiert sie vor allem für ihre Instagram-Posts. Bei einem gemeinsamen Abendessen spricht er an, dass sie ihn mit etwas zu viel Selbstverständlichkeit für das Essen zahlen lässt, obwohl sie doch mehr verdiene. Beim darauf folgenden Streit wird er öfter rufen: „Es geht nicht um’s Geld!“ – aber eigentlich tut es genau das. Die Schwierigkeit, über Geld zu sprechen und über die damit zusammenhängenden Rollenbilder, setzt den Ton für den Film. Auch die Fashion-Branche wird gestreift in dieser ersten Episode: Ihr Umgang mit der Klimakatastrophe wird, stellvertretend für viele, auf einer Modenschau beschrieben als „Zynismus, verkleidet als Optimismus“ – ein Vorwurf, den man Triangle of Sadness nicht machen kann, denn Regisseur Ruben Östlund verkleidet seinen Zynismus in den folgenden zweieinhalb Stunden nicht.
Distanz als Vermessenheit

Unvermittelt finden wir Yaya und Carl auf einer Luxusyacht wieder, die Reise ist ein Werbegeschenk an die Influencerin. Sie sind nun nur noch bedingt die Hauptfiguren, vielmehr zwei Gäste unter vielen: sich an Deck räkelnde Reiche und/oder Schöne, allesamt unsympathisch bis ins Mark und mindestens ein bisschen dumm. Flegelhaft und selbstgefällig führen diese Leute sich auf, ohne je ihre Rollen zu verstehen; Yaya und Carl bilden keine Ausnahme. Zu Beginn mag man da noch eine genüssliche Verachtung verspüren, aber je weiter die Farce voranschreitet und die Unausstehlichkeiten zunehmen, desto mehr läuft sich diese Verachtung leer. Was wir zu sehen bekommen, befindet sich durchgehend etwa auf dem Level von Madonna, als sie 2020 aus einem Schaumbad mit Rosenblättern heraus vom „großen Gleichmacher“ Covid-19 sprach.
Fredrik Wenzels Kamera nimmt alles ganz unverkrampft und en passant in geschmackvoll komponierten Bildern zur Kenntnis, sei es das Servieren von Champagner oder die Explosion einer Handgranate. Der Film lädt uns mit dieser zurückhaltend-beobachtenden Art zur Distanz ein. Diese Distanz kann nun zweierlei bedeuten: zum einen eine analytische Haltung, die das Gezeigte abstrahieren, einordnen, theoretisieren will. Zum anderen, und das ist leider oft der Fall, nur einen süffisanten Blick auf die Kabbeleien der begüterten Gesellschaft, der sich auf unkonkrete Art erhaben weiß über die menschlichen Irrungen.
Ja sagen ist erste Pflicht
Woody Harrelson gibt den Kapitän, der meist betrunken in seiner Kajüte sitzt und sie nur zu Repräsentationszwecken verlässt – namentlich das Kapitänsdinner bei hohem Seegang. Im Lauf des Abends kommt es zu allerlei Katastrophen und viel Erbrochenem. Der Kapitän (er bezeichnet sich selbst als Scheißsozialisten) und ein russischer Düngermillionär (ein Kapitalismusapologet, der gerne erzählt, dass er Scheiße verkauft, gespielt von Zlatko Burić) saufen sich unter den Tisch und liefern sich hohle Zitatschlachten, in denen Lenin gegen Thatcher steht. Östlund möchte hier verhärtete und sinnentleerte Rechts-links-Grabenkämpfe vorführen, demonstriert aber nur die beschriebene zweite Bedeutung seines distanzierten Blicks. Kopfschüttelnd steht er da, sagt „O ihr Toren“ und lächelt in sich hinein. Kluge Pointen und produktive Konfrontationen muss man in anderen Szenen suchen.

Etwa die, in der eine Passagierin in einem Anfall von fehlgeleiteter Menschenliebe das Personal auffordert, den Dienst sein zu lassen und schwimmen zu gehen. Da Ja zu sagen die erste Pflicht des Personals ist, findet in der Folge die befehlsmäßige und wunderbar in Szene gesetzte Organisation des Badespaßes statt: Alle Abläufe sind gestört, Stress greift um sich. Hier und an anderer Stelle arbeitet Östlund gut heraus, wie ein Jargon der „Gleichheit“, der „inneren Werte“ und der „Menschlichkeit“ als schwache Übertünchung von Machtverhältnissen dient.
Schiffbruch mit Ausbeutung
An dieser Stelle muss verraten werden, dass das Schiff sinkt. Der dritte Teil des Films hebt an und zeigt die Schiffbrüchigen, die sich auf einem Eiland neu organisieren müssen. Die Inselökonomie setzt alles auf null, und Abigail (Dolly De Leon), die auf dem Schiff Toilettenmanagerin war, fordert nun den ihr zustehenden Teil an allem, was noch vorhanden ist, ein. Denn sie ist die Einzige, die Feuer machen und Fische fangen kann. Kurz bricht sich hier ausgleichende Gerechtigkeit Bahn, aber prompt entstehen neue Ausbeutungsverhältnisse, in denen bestimmte Kapitalsorten bedeutsamer werden: Salzstangen werden gegen Sex eingetauscht, Knecht und Herr haben nur die Plätze getauscht. Jaja, erst das Fressen, dann die Moral, so ist der Mensch nun mal, was will man machen.

Und diese Haltung dominiert leider in Triangle of Sadness, obwohl es hin und wieder brillante Momente gibt. Das Sprechen über Geld, die Modeindustrie, emotionale Arbeit, Influencer, Kommunismus und Kapitalismus, Utopien und Tristesse, Eifersucht und Ausbeutung, diese Themen sind benannt und vereinzelt klug umgesetzt, aber werden nur bedingt verknüpft und kaum weitergedacht. Die Haltung des Films soll bissig sein, aber meist ist sie allzu wohlfeil und zieht ihre Hauptsubstanz daraus, im wahrsten Sinne des Wortes unverschämt reiche Leute zu zeigen. Die gibt es, aber darüber muss mehr zu erzählen sein.
Der Film steht bis 17.12.2024 in der Arte-Mediathek.
Neue Kritiken

The Day She Returns

Prénoms

Douglas Gordon by Douglas Gordon

If Pigeons Turned to Gold
Trailer zu „Triangle of Sadness“




Trailer ansehen (4)
Bilder

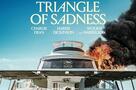


zur Galerie (7 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
fifty
Ihre Kritik trifft Stärken und Schwächen des Films sehr gut, danke! Vielleicht hätte Östlund es ähnlich wie Rian Johnsons „Glass Onion“ (ebenfalls 2022) einfach bei einer lustvoll konsequenten Abrechnung mit dem Kapitalismus belassen sollen? Zusätzlich auf die Geschlechterthematik abzuheben, wirkte auf mich nicht stringent, sondern eher wie eine pflichtschuldig politisch-korrekte (Anti-)Reaktion auf den Zeitgeist. Es wird bemüht konstruiert, durchschaubar invertiert und immer wieder ausformuliert, wo man hätte durch kleine Leerstellen brillant dekonstruieren können. Dass der Regisseur ein Meister darin ist, wissen wir ja seit „White Square“ oder „Höhere Gewalt“; geniale Filme, die ihre Themen so gekonnt in der Schwebe halten, dass sie ein ganz eigenes, d.h. filmisches und nicht nur intellektuelles Gewicht besitzen.


















1 Kommentar