The House That Jack Built – Kritik
Die Nazis und ihr Sinn für Ästhetik dürfen wohl nicht fehlen in einem Opus über die Schönheit des Mordens. Lars von Trier hat mit The House That Jack Built wieder einen Schocker inszeniert und langweilt – bis zum fulminanten Finale.

Klar ist das eine Provokation. Ob sie aber wirkt oder nicht, das ist nicht so leicht zu entscheiden. Immerhin: Als bei der Vorführung von The House That Jack Built beim Festival von Cannes ein Bild mit Adolf Hitler auftaucht, geht ein Raunen durch das Kino. Vor sieben Jahren hatte sich Lars von Trier bei einer inzwischen berühmt-berüchtigten Pressekonferenz in Cannes als Hitlerversteher und als Nazi bezeichnet. Aussagen, die er zwar im Anschluss bereute und zurücknahm, die aber dennoch nachhallen. In seinem neuesten Film verwendet der Regisseur wieder viel Fremdmaterial – Gemälde, Fotos, Videoschnipsel – das, ähnlich wie in Nymphomaniac (2013), durch eine Art Stream-of-Consciousness-Gespräch hergeleitet werden. In diesem Fall wird dieses Gespräch von einem Serienmörder bestimmt. Dass Bruno Ganz, der vermutlich bekannteste Hitler-Darsteller unserer Zeit, die andere der beiden Rollen in dieser Unterhaltung aus dem Off spricht, dürfte kein Zufall sein.
Ein Serienmörder mit Putzzwang

Der Auftritt von Hitler und der kruden These von Jack (Matt Dillon), dass das Verwesen von Menschen diese zu Kunstwerken mache, kommt vielleicht genau zum richtigen Moment in The House That Jack Built. Zuvor war von Triers Erzählung vom soziopathischen Serienmörder, der sich selbst Mr. Sophisticated nennt, ein bisschen ins Stocken geraten, oder anders gesagt: zu seiner Essenz vorgedrungen, der Langeweile. Denn Jack ist kein Patrick Bateman aus American Psycho, seine Hingabe zum Töten hat eher mechanische denn leidenschaftliche Züge. Während der fünf tödlichen „Vorfälle“, von denen er Verge (so heißt die von Ganz gespielte Figur) berichtet und die den Film strukturieren, wirkt er so brutal wie unbeteiligt. Die sonderbare Schnodderigkeit der Hauptfigur übersetzt der Film in komödiantische Töne. Eine frühe Szene beschäftigt sich mit seinen Zwangsvorstellungen, die dafür sorgen, dass der Mörder immer wieder an einen Tatort zurücktrottet, um sauber zu machen, obwohl weit und breit keine (Blut-)Flecken zu sehen sind.
Töten als Gesamtkunstwerk

Stilistisch setzt Lars von Trier erneut auf ein Potpourri, wechselt mal geschmeidig, mal rabiat zwischen intensiver Detailversessenheit, elliptischer Konzentration, gezieltem Spannungsaufbau und lockerem Rückblick aus sicherer Entfernung. In der Kombination mit den wiederkehrenden Schnelldurchläufen durch die Kunstgeschichte und einem ins Abstrakte reichenden Schluss, ergibt sich ein reichhaltiges Angebot an Anknüpfungsmöglichkeiten. Das Fundament dafür (oder dagegen) bildet der über weite Strecken des Films im Off geführte Disput zwischen Jack und Verge, der vieles von einem therapeutischen Selbstgespräch hat: Jack rechtfertigt seine Handlungen, sucht nach Erklärungen und Zusammenhängen, Verge sät die Zweifel und übt Kritik. Die Konstellation unterscheidet sich insofern von der in Nymphomaniac, bei der der Zuhörer noch mehr Verständnis für die Protagonistin hatte als sie selbst. Um Moralität und deren Grenzen kreist aber auch The House That Jack Built, nur ohne dass sich ähnliche Ambivalenzen einstellen würden.
Lars von Trier gibt seinem Protagonisten zwar verbal viel Raum, filmisch dagegen stellt sich wenig Empathie mit ihm ein. Das liegt zum einen daran, dass Jack als ein Loser dargestellt wird, dessen Projekt zum Scheitern verurteilt ist. Die Idee vom Gesamtkunstwerk des Serienmörders, ob man ihr nun etwas abgewinnt oder nicht, hält zum anderen keine Sekunde mit den ins Bild geführten tatsächlichen Kunstwerken mit. So oft wie Glenn Goulds Klavierinterpretationen als kleine Einsprengsel wiederkehren, so oft macht uns von Trier bewusst, dass Jack nicht viel kann, als Ingenieur und als Architekt kaum etwas vorzuweisen hat und auch seine mehr als 60 Morde eher durch Glück als wegen seiner vermeintlich ausgetüftelten Methoden erst so spät aufgedeckt wurden.
Extravaganz erst am Ende

The House That Jack Built ist ziemlich abgehoben, guckt herab und hat Spaß am Beobachten der Figuren, obwohl der Film stilistisch mit seiner Handkamera eine größere Nähe verspricht als er erzählerisch einlöst. Und doch gelingt es von Trier zwischendurch, erschreckende Albtraumbilder zu produzieren, die gerade durch ihre Beiläufigkeit dem Horror huldigen. Dazu gehört vor allem eine Rückblende, die den jungen Jack zeigt, bei einer seiner ersten brutalen Verstümmelungen an einem kleinen unschuldigen Tier. Aber auch einige der Szenen in seinem riesigen Gefrierzimmer, in denen er seine Toten wie Trophäen versammelt und herrichtet, bleiben als Bilder in Erinnerung. Nichts im Film kann allerdings mit dem Epilog konkurrieren, bei dem von Trier an bildnerische Extravaganz wie im Prolog von Melancholia anschließt. Es sind Momente, in denen plötzlich die Kompositionen für sich selbst sprechen, ihre eigene Moral und Faszination entwickeln. Sie sind das Kunstwerk, zu dem Jack nicht vordringen konnte ohne die Hilfe von Ganz/Hitler/Verge. Ihre gemeinsame Reise im fulminanten Schluss kommt zu spät, lässt aber tief blicken. Immerhin darin enttäuscht Lars von Trier nie.
Neue Kritiken

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho

Die Spalte
Trailer zu „The House That Jack Built“

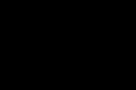
Trailer ansehen (2)
Bilder




zur Galerie (12 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.
















