The French Dispatch – Kritik
Wes Andersons The French Dispatch sehnt sich danach, ein Magazin zu werden und das Publikum zu seiner gebannten Leserschaft zu machen. Beim Durchblättern mitzukommen ist nicht ganz leicht.

Das Presseheft zum Film, normalerweise nicht der Erwähnung wert, habe ich diesmal gerne durchgeblättert. Es ist – vom Titelblatt übers Layout des Innenteils bis zu den Anzeigen – wie eine Ausgabe von „The French Dispatch“ gestaltet, der imaginären Magazinbeilage und, nun ja, Hauptfigur von Wes Andersons neuem Film. Es schließt sich dessen detailverliebter Gestaltung an und bezeugt eine sozusagen bis hin zur Positionierung jedes Buchstabens akkurate künstlerische Vision.
Der ultimative Wes-Anderson-Film

Auf dieser gestalterischen Ebene ist The French Dispatch wahrscheinlich der bisher ultimative Wes-Anderson-Film, den artifiziellen Stil als „wiedererkennbar“ zu bezeichnen wäre grotesk untertrieben. Und diesmal ist der entworfene ästhetische Kosmos nicht mehr irgendeiner darin erzählten Geschichte äußerlich – der Entwurf dieses Kosmos ist selbst die Geschichte, der Gegenstand, das Thema des Films. Gespeist wird dieser Entwurf aus zwei Inspirationsquellen, dem legendären US-Magazin The New Yorker zum einen, Wes Andersons französischer Wahlheimat zum anderen. Das Amalgam daraus ist eben jene titelgebende Magazinbeilage, die der Film auf der Leinwand zum Leben erweckt oder, vorsichtiger: in Bewegung bringt.

Tatsächlich ist die „Handlung“ von The French Dispatch ein sich vor Augen und Ohren des Publikums vollziehendes Durchblättern, Vorlesen, Eintauchen in die letzte Ausgabe des Heftes, die zum Andenken an den, wie wir gleich zu Beginn erfahren, verstorbenen Herausgeber Horowitz (Bill Murray) erschien und drei der nach Meinung der Redaktion besonders stilprägenden Artikel versammelt. Zusammen mit einer einführenden Glosse, in der Owen Wilson als radelnder Reporter das imaginäre Städtchen Ennui-sur-Blasé vorstellt – ein Puppenhaus-Paris, in dem sich der redaktionelle Außenposten des in Kansas ansässigen Mutterheftes befindet – enthält der Film also dreieinhalb separate Erzählungen.

Eine von Tilda Swinton gespielte Kunstkritikerin schreibt, erstens, über einen malenden Mörder im Knast (Benicio del Toro), dessen Wärterin (Léa Seydoux) ihm zur Muse für ein epochemachendes abstraktes Gemälde wird. Frances McDormand als Politjournalistin verliebt sich, zweitens, im Pariser (pardon, Ennui-sur-Blasér) Mai ’68 in Timothée Chalamet als Studentenführer, was sie beim Schreiben ziemlich korrumpiert. Und drittens spinnt ein Gastrokritiker (Jeffrey Wright) aus dem Fall um einen entführten Kommissarssohn eine kulinarische Giftmordgeschichte. Diese Storys sind noch in sich in mehrere Ebenen geschachtelt – die Kunstkritikerin etwa hält ihren Text als Vortrag, den der Film dann in Flashbacks zeigt, der Gastrokritiker ist Gast in einer Talkshow – und dazwischen sind Szenen aus dem früheren Redaktionsalltag geschnitten, die die Entstehung(snöte) der Artikel und Horowitz als verständigen Übervater zeigen.
Jede Menge Französisches

Dass diese dreieinhalb Episoden, abgesehen davon, verschiedene Artikel desselben Heftes zu verkörpern, keine inhaltliche Verbindung haben, dass es keinen übergreifenden Erzählbogen und keine zentrale Hauptfigur gibt, kann man dem Film schwerlich vorwerfen, da seine Absicht offenkundig eine andere ist. Vielleicht kann man sagen, dass sich The French Dispatch danach sehnt, selbst dieses Magazin zu werden und das Publikum zu seiner gebannten Leserschaft zu machen, es auf diesem Weg an der Aura einer oder gleich mehrerer geliebter Epochen teilhaben zu lassen: Die Schaffenszeit Horowitz’ erstreckt sich von 1925 bis 1975, und so entfalten sich vor unseren Augen jede Menge französische Moden, französisches Kunstschaffen, französische Politbewegtheit, französische Kulinarik und Kriminalistik, französische Romanze, so wie wir uns vorgestellt hätten, dass Wes Anderson es sich so vorstellt. Oder wie es sich New-Yorker-Autor*innen, wie er sie sich vorstellt, vorstellen würden. (In vielen Bildern auch so, wie andere Filmemacher, etwa Tati oder Truffaut, es sich seiner Vorstellung nach vorgestellt hätten.)

Fantastisch anzusehen ist das alles. Mehr denn je schöpfen Wes Anderson und seine Crew in Sachen Ausstattung und Bildgestaltung aus dem Vollen, variieren mit Bildformaten, wechseln zwischen Farbe und Schwarz-Weiß, Real- und Animationsfilm, es wimmelt vor Spielereien und Tricks. Dazu ein Cast, bei dem, wie es scheint, das halbe Gegenwartskino auf- und abtritt. Wäre der Film tatsächlich dieses Magazin – angesichts der Überfülle wohl eher ein kiloschweres Coffeetable-Book –, man könnte stundenlang über jeder Doppelseite brüten und hätte womöglich noch immer nicht alle Anspielungen, Doppelbödigkeiten und Ironien entdeckt oder alle realen Vorbilder der vielen Figuren und angerissenen Geschichten identifiziert.
Alles wohlgeordnet an seinem Platz

Aber bei einem Film, in dem man nicht vor- und zurückblättern, den einen Text überfliegen und sich ins andere Bild vertiefen kann, wäre es hilfreich, etwas zu finden, worin man sich einhaken kann, das einen durch den Film trägt oder dazu animiert, sich hindurchzuwühlen. Das ist bei The French Dispatch nicht so leicht. Ehe man sich’s versieht, ist er an einem vorübergeglitten. Woran liegt das? In den meisten Anderson-Filmen schlummerte unter der pastellenen Oberfläche eine tiefe Melancholie, verfolgte die Kamera die mehr schlecht als recht durch ihr beschädigtes Leben tapsenden Sonderlinge mit Sympathie und Neugier. Und eigentlich würden auch hier viele der Figuren gut in dieses Panoptikum passen. Bloß scheinen sie diesmal in den wohlgeordneten Symmetrien seiner Bildwelten förmlich festgezurrt – alles, was wir über sie und ihre Welt erfahren, jedes der unendlich vielen liebevollen Details in diesem Kosmos wird von der Kamera (oder, übergeordnet, der Erzählinstanz) präsentiert, nichts wird von ihr entdeckt. (Eine wie auch immer geartete Entdeckungsreise hat diese Erzählinstanz längst hinter sich, sie vertraut einfach darauf, dass uns das, was sie uns vorsetzt, genauso begeistert.)
Es wäre falsch zu sagen, dass der Film trotz allem „viele tolle Momente“ hat – es könnten, entfesselte man sie, sogar unzählige sein, aber jeder einzelne ist im Gefüge fest vertäut. In einer Szene am Ende der ersten Story, kurz nach dem Gefängnisaufstand, friert das Bild ein und fährt die Kamera an den mitten in wilder Bewegung festgehaltenen Figuren entlang. Ein unfreiwilliges Symbolbild für einen Film, in dem mächtig was los ist und sich kaum was bewegt.
Neue Kritiken

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho

Die Spalte
Trailer zu „The French Dispatch“

Trailer ansehen (1)
Bilder

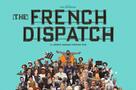


zur Galerie (18 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.

















