Tangerine L.A. – Kritik
Sean Baker hat einen Film mit nichts als einem gepimpten iPhone gedreht – und doch fühlt sich sein „Sundance-Hit“ mehr nach Kino an als viele andere Träger dieses Labels der letzten Jahre.

Alexandra hat den ganzen Film lang immer wieder Flyer verteilt, aber am Ende ist niemand gekommen außer ihrer besten Freundin. Doch Alexandra ist die fehlende Resonanz egal. In ihrem Blick liegt weniger akute Enttäuschung als die chronische Traurigkeit eines Menschen, der sich an die Folgenlosigkeit der eigenen Wünsche gewöhnt hat und (sich) trotzdem an ihnen festhält. Deshalb singt sie einer leeren Theke entgegen. In einem anderen Film wäre eine solche Szene vielleicht rührselig geworden, „emotionaler Höhepunkt“ der mitleidenden Zeugenschaft eines tragischen Opferlebens: arme transsexuelle schwarze Prostituierte, ohne Hoffnung. In Sean Bakers Tangerine ist diese Gesangseinlage herzzerreißend, gerade weil sie keinen Höhepunkt markiert, weil nichts auf sie hinausläuft außer die banalen Flyer, weil sie Randnotiz ist in diesem Film und doch so wichtig. Und vor allem weil Alexandra keine Figur ist, die mit dieser Szene im Hinterkopf erdacht worden ist. Tangerine hört seinen Figuren zu, verdoppelt diese bescheidene, passive Haltung aber nicht durch eine reduzierte Form. Im Gegenteil: Bunt, laut und vollkommen konstruiert ist dieser Film.
Besondere Produktionsbedingungen

„Shot on the iPhone S5.“ Der Satz kommt spät in den Credits, aber wenn man schon vor der Sichtung von Tangerine um die Produktionsbedingungen weiß, ertappt man sich dabei – ähnlich wie zuletzt bei Sebastian Schippers Victoria –, erst mal auf den Effekt der eigenwilligen Form zu achten, statt sich tatsächlich auf den Film einzulassen. Gut also, dass es die beiden transsexuellen Protagonistinnen gibt, Sin-Dee Rella (Kitana Kiki Rodriguez) und eben jene Alexandra (Mya Taylor), die mit einem dermaßen hyperaktiven Dialog in einem Donut-Laden loslegen, dass man das Drumherum erst mal vergisst. Zuhören. Dank dem enormen Sprech- und Erzähltempo ist das gar nicht so einfach, auch wenn die Eckdaten des Plots schnell klar sind: Sin-Dee kommt frisch aus dem Gefängnis und erfährt von Alexandra, dass ihr Zuhälter und Liebhaber Chester (James Ransone) sie betrogen hat – mit einer weißen Von-Geburt-an-Frau. Auch wenn Alexandra ihrer Freundin das Versprechen „No Drama!“ abnimmt, zeugen die wummernden Dubstep-Beats, mit denen Baker seinen Film fortan immer wieder unterlegt, vor allem von der Wut und Rachelust Sun-Dees.

Nicht nur die treibende Musik, auch die übersättigten Farben kommen mit der Straße erst so richtig zur Geltung, und Tangerine braucht dann eine Weile, bis sich aus der in Schnitttempo und Pop-Look zunächst arg an Musikvideos erinnernden Ästhetik eine wunderbar stimmige Behausung für seine Figuren herausschält. Bakers Film sieht (dank des Prototypen eines Anamorphic-Adapters für das Smartphone und einer Post-Produktion ohne falsche Zurückhaltung) dabei mal so gar nicht nach Selfmade-Video aus, sondern scheint wie für die große Leinwand gemacht. Die Farbenfröhlichkeit – der Film spielt an einem sonnendurchfluteten Heiligabend in einer verruchteren Gegend Hollywoods – ist dabei nicht nur Absage an die trist-dreckige Straßenästhetik, die Sujets dieser Art so häufig begleitet. Sie ist die rosa Brille, die der Film uns aufsetzt. Eine rosa Brille, die aber nicht die Realität verklärt, sondern unsere Wahrnehmung verzerrt: um die Distanz zu lockern und die Neugier zu wecken, auf dass wir uns nicht mitleidig, sondern lustvoll und spielerisch mit diesem Milieu und seinen Bewohnerinnen auseinandersetzen.
Nichts beschönigt, nichts verurteilt

Der Plot, Sin-Dees Rachefeldzug, ist dabei nur vorgeschobener Grund, ihr folgen zu dürfen. Ihre Bewegungen auf der Suche nach der Bitch, die ihren Typen gevögelt hat, bilden die queere Linie, die der Film zieht. Diese Linie zeichnet keine marginalisierte Welt, sondern einen eigenen Mikrokosmos, in dem das Normative, die allmächtigen Instanzen, nur an den Rändern aufscheinen. Begegnungen mit der Polizei, mit Freiern, mit Kneipenbesitzern sind nachbarschaftliche Aushandlungsprozesse verbaler oder körperlicher Art. Was nicht heißt, dass Baker uns hier ein Leben ohne Widrigkeiten und Abhängigkeiten suggeriert. Überhaupt hat der grundsätzlich lebensbejahende Blick, den Tangerine auf seine Figuren wirft, nichts von unkritischer Romantisierung. Sin-Dee findet das Objekt ihrer Eifersucht Dinah (Mickey O’Hagan) schließlich in einem zum Mini-Bordell umfunktionierten Hotelzimmer, in dem schwitzende, fette Männerleiber sich an zierlichen Frauenkörpern reiben. Nur einen kurzen, orientierungslosen Blick erhaschen wir auf diesen Ort und können ihn doch nicht vergessen. Am Ende wird Dinah hierhin zurückkehren wollen und darf es nicht.

Auch derlei Hoffnungslosigkeiten kommen still daher und wirken umso länger nach. Nichts wird beschönigt, nichts verurteilt. Die Prostituierten von Tangerine sind zu keiner Zeit die Ganzanderen, die wir neugierig betrachten; sie sind weder die verunsicherten Transsexuellen, die sich mit Identitätskrisen herumschlagen, noch die armen Prostituierten, die „ganz unten“ gelandet sind. Sie sind Zentrum ihrer eigenen Welt, die für einen kurzen Moment Kino und damit die unsere wird.
Nach dem Showdown

Zu dieser Welt, denn sie ist in alle Richtungen offen, gehört auch der armenische Taxifahrer Razmik (Karren Karagulian), dessen Erlebnisse mit Fahrgästen im ersten Teil des Films für scheinbar beliebige narrative Ablenkungen sorgen, der sich aber irgendwann als befreundeter Stammkunde unserer Protagonistinnen entpuppt. Irgendwann wird Ramzik im Donutladen stehen, zwischen seinen transsexuellen Bekanntschaften und einer wildgewordenen Schwiegermutter, die wissen will, wer diese Leute sind. Sprengung eines Doppellebens, auch davon erzählt Tangerine auf einmal, ohne dass man es hat kommen sehen. Dann macht dieser hysterische Showdown Platz für ein wunderschönes Ende, in dem die anwesenden Männer – motiviert durch den Plot, aber irgendwie auch wie von Zauberhand – entfernt werden. Nach einem Streit und einer Begegnung mit dem Hass jener, die ihren Anblick nicht aushalten, landen Alexandra und Sin-Dee in einem Waschsalon und können nichts mehr sagen, sich nur noch schüchtern Nähe spenden. Da kommt der Film zu sich: Nicht um Sexualität oder Identität geht es, sondern um Freundschaft und Solidarität, kleine Träume und Hoffnungen, Musik und Farben, und immer wieder Rückschläge.
Neue Kritiken

Douglas Gordon by Douglas Gordon

If Pigeons Turned to Gold

Don't Come Out

Dead of Winter - Eisige Stille
Trailer zu „Tangerine L.A.“

Trailer ansehen (1)
Bilder
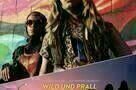



zur Galerie (8 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Ule
stellt doch mal den richtigen Trailer rein - offensichtlich gibts noch den anderen deutschen Film , der "Tangerine" heißt (?)
Michael
Danke für den Hinweis. Ist jetzt korrigiert. Es gibt tatsächlich einen deutschen Film, der ebenfalls Tagerine heißt (und zwar der hier: http://www.critic.de/film/tangerine-1635/).
Michael
Ich meinte natürlich "Tangerine"











3 Kommentare