Oppenheimer – Kritik
Oppenheimer, der Titan: Man mag Christopher Nolan die Überambition vorwerfen, mit der er seinem Helden Göttlichkeit aufbürdet. Doch dass wir uns wohl oder übel auf seine Seite stellen, liegt weniger in der Biopic-Dramaturgie begründet als in Nolans Ethos.

Die Sonne ist das erste Bild, mit dem die Montage uns in die entsetzlichen Weiten von Robert Oppenheimers Verstand hinabstürzt. Ein Bild, das Anfang und Ende der Menschheitsgeschichte symbolisiert, die der amerikanische Physiker für immer verändern wird. Kernfusion. Der Vorgang, der die Sonne Energie abstrahlen lässt. Eine energetische Reaktion älter als die Erde, die die Menschheit verstehen und die Menschheit nutzen wird, um die Möglichkeit ihrer eigenen Vernichtung zu realisieren. Der direkte Blick in das Bewusstsein Oppenheimers ist der erste Moment, der diese Möglichkeit offenbart. Eine Möglichkeit, die gerade deswegen so furchtbar ist, weil sie theoretisch ist. Geboren in einem Verstand, der Sterne sterben, Neutronen bombardieren und das göttliche Feuer entbrennen sieht. Jenes Feuer, das er selbst auf die Erde bringen wird.

American Prometheus heißt das von Kai Bird und Martin Jay Sherwin geschriebene Buch, auf dem Christopher Nolans Film basiert. Eine ausufernde Biografie, aus der Nolan nicht Oppenheimer, den Nerd, den einsamen Jungen, den Hobby-Geologen, pathetischen Poeten und zerbrechlichen Eigenbrötler extrahiert, sondern Oppenheimer, den Titanen. Den Mann, der die eigene Fragilität überwindet, indem er sich in die unendlichen Weiten seines Verstandes zurückzieht, um aus ihnen aufzuerstehen, als ein Mann, der nicht nur die Geschichte der Menschheit, sondern die Geschichte des Planeten prägen wird. Bevor es dazu kommt, ist er Rockstar in Reithosen, Alleskönner in Harvard und Ladies Man in Berkeley. Übermensch. Überall.
Der Titan

Nolan macht den Titanen zum Superhelden, lässt ihn die eigentliche befohlene Uniform des US-Militärs abstreifen, um Pfeife und Hut als sein neues Kostüm anzulegen. Oppenheimer ist der Star des Allstars-Teams der Physik, das das Zeitalter der Quantenmechanik und damit das Zeitalter der Nuklearwaffen einläutet. Ebenbürtig ist nur Einstein selbst (Tom Conti), der als Orakel durch den Film spukt, das Oppenheimer immer dort konsultiert, wo die Monstrosität des Projekts selbst ihm zu entgleiten droht.

Man mag dem Film seine Gigantomanie vorwerfen. Mag augenrollend die Überambition feststellen, mit der das Bhagavad-Gita-Zitat („Now I am become Death, the destroyer of worlds“) eine Verbindungslinie von Sex bis Trinity schlägt. Aber natürlich gehört eben gerade das zum Mythos, den sich Nolans Kino ohne Scham und mit der gleichen Vehemenz zurechtbastelt, mit der das Internet das Pathos aufgreift, um es lustvoll mit der pinken Farbe von Sommerblockbuster-Schwester Barbie zu besudeln. Nolan bleibt ernst, befeuert selbst die Momente mit Fission, Fusion und Feuer, in denen Oppenheimer als Mensch aufzutreten hat. Bürdet ihm auch dort die filmisch entworfene Göttlichkeit auf, wo er befragt, verhört, geliebt und gehasst wird. Das Nötigste aus dem Leben, das der Mensch lebt, wenn er nicht Gott, Genie oder Bombenvater ist, komplettiert das Biopic mit pointierten Andeutungen und elegant abgekanzelten Nebensträngen. Die Affäre mit Psychiaterin und Kommunistin Jean Tatlock (Florence Pugh), die Ehe mit Biologin Kitty Oppenheimer (Emily Blunt), die Depressionen, unter denen alle leiden, sind gut pointierte Fußnoten des Epos, das hier in Form gebrannt wird. Statt ein Privatleben gegen die Größe von Oppenheimers Schaffen zu stellen, den Alltag und Experimente des Manhattan Projects oder gar die einzelnen Schritte auf dem Weg zur Bombe nachzuzeichnen, kreist Nolan die Gigantomanie des Zeitalters der Nuklearwaffen mit der Gigantomanie seines Filmschaffens ein.
Das Unwesen

Oppenheimer beschreibt das, was noch Theorie ist, mit großen Worten, verbildlicht den Prozess von der Berechnung zur Zündung in visuellen Metaphern und kehrt zur prosaischen Realität zurück, als die Bombe geboren ist, als hässliche anthrazitfarbene Kugel, die den Plutoniumkern im Herzen und Sprengstoffplatten im Leib trägt. Was Robert Oppenheimer am Tag vor dem Trinity-Test in der Wüste inspiziert, ist ein missgestalteter, von unzähligen Drähten und Kabeln am Leben erhaltener Maschinenkörper. Ein Unwesen, dessen schiere Existenz eine permanente Drohung an alles Leben ausspricht. Nolan ist ambitioniert und vehement genug, dieses Unwesen begreifen und inmitten unserer Zivilisation verorten zu wollen. Als in den Meetings der politischen Führungsriege und der Atomenergiekommission die unabdinglichen ethischen Fragen dazu gestellt werden, offenbart sich, wie absurd der menschliche Pragmatismus im Angesicht der übermenschlichen Macht wirkt. Kyoto sei eher kein Ziel, zu bedeutend, zu sehr als Urlaubserinnerung im Gedächtnis von Kriegsminister Stimson verankert. Ein militärisches Ziel kann auch niemand nennen. Es existiert schlichtweg keins für die Größe der Waffe, die man hier einzusetzen gedenkt. Überhaupt ist der Einsatz dieser Waffe, und auch diesen Kontext erarbeitet sich Nolan in den drei Stunden Filmlaufzeit, nur in der Massenvernichtungslogik denkbar, die der Zweite Weltkrieg, genauer der Pazifikkrieg der Regierung Truman, auferlegt.
Das ewige Verschlingen der Eingeweide

Tatsächlich arbeitet Oppenheimer eben nicht auf den Moment hin, in dem die Menschheit das alles vernichtende göttliche Feuer das erste Mal zu Gesicht bekommt. Nolan behauptet den Mythos auch dort, wo es aus dem unmittelbaren Auge der Geschichtsschreibung verschwindet. Dort, wo der Titan selbst in den hinteren Winkel einer Abstellkammer verwiesen wird und wie ein gescholtener Schuljunge zusieht, wie seine Kollegen und seine Frau verhört, sein Name geschmäht und seine Verdienste aus den weltgeschichtlichen Höhen auf den antikommunistischen Boden der Tatsachen zurückgezerrt werden. Robert Downey Jr. als Lewis Strauss und Jason Clarke als der von Strauss eingesetzte Roger Robb sind diejenigen, die die Kleinkariertheit der Menschheit in ihren Performances bündeln. Clarke gibt sich als garstiger Ankläger, der Kitty Oppenheimer buchstäblich mit Schaum vorm Mund verhört, während Downey Jr. seine Böser-Onkel-Performance bis zum Bond-Bösewicht-Dasein überreizt und sich die Kaffeetasse wollüstig an den Lippen reibt. Das Nolan’sche Pathos ist beim Fall des Titan gewordenen Oppenheimer ebenso sichtbar wie bei seiner Apotheose. Die von Strauss angezettelte, weltgeschichtlich gänzlich unbedeutende Hexenjagd auf Oppenheimer, nicht weniger mythologisch überladen als der Moment, in dem das hellste Licht erstrahlt, das die Menschheit je gesehen hat (und wie könnte es heller strahlen als auf 70-mm-Film?). Das letzte Drittel des Films ist die McCarthy-Ära als ewiges Verschlingen von Oppenheimers Eingeweiden. Fast stellt der Moment, in dem ein namenloser GI dem Vater seine Bombe abnimmt, all die wahnwitzigen Bilder in den Schatten, die Nolan und Kameramann Hoyte Van Hoytema auffahren, um der Enormität des Trinity-Tests gerecht zu werden (und wer könnte sie größer machen als Nolan?). „We’ll take it from here“, lässt der Soldat verlauten, als er Oppenheimer das Feuer abnimmt.
Das Vermächtnis des Feuers

Dass Nolan an der Seite der selbst geschaffenen Gottheit bleibt, liegt weniger in der Biopic-Dramaturgie begründet als in Nolans Ethos. Sein Film sagt uns, dass wir wohl oder übel auf der Seite des Mannes, des Titanen stehen, der das Feuer bringt. Als Harry Truman ihn aus dem Weißen Haus wirft, weil er es für anmaßend hält, dass Oppenheimer und nicht er „Blut an den Händen“ habe, ist das mehr denn ein gleichermaßen Tabloid-tauglicher und historisch signifikanter Moment. Es ist die Szene, die verdeutlicht, dass Prometheus selbst seine Gabe und seine Schuld versteht. Nicht die drei in Los Alamos gebauten Bomben stellen die Perversität einer Welt mit Atomwaffen dar, sondern das, wie es bei Günther Anders heißt, selbst bei vollständiger Abrüstung auf ewig fortbestehende, auf die Welt getragene Wissen. Das Wissen um die Technik, die alles Leben auszulöschen vermag. Weil es um eben dieses Wissen geht, ist nicht Trinity das Ende von „Oppenheimer“, sondern sein Vermächtnis. Das Vermächtnis, mit dem Prometheus leben muss, wir alle leben müssen.
Neue Kritiken

Die Blutgräfin

Crocodile

Auslandsreise

AnyMart
Trailer zu „Oppenheimer“
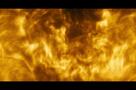

Trailer ansehen (2)
Bilder




zur Galerie (28 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.
















