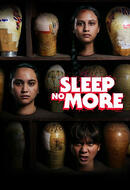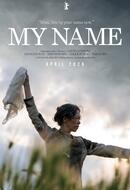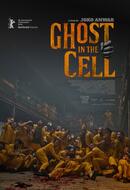My Days of Mercy – Kritik
Auge um Auge, Aug’ in Aug’: My Days of Mercy ist eine Liebesgeschichte, die ihren Rhythmus in einer Abfolge von Hinrichtungen findet, aber von politischen Fragen abgeschirmt bleibt.

Als sich die Blicke von Lucy (Ellen Page) und Mercy (Kate Mara) zum ersten Mal treffen, wurden die Konfliktlinien bereits binnen weniger Augenblicke abgesteckt: auf der einen Seite eine junge Frau, die sich gegen die Todesstrafe engagiert; auf der anderen eine junge Frau, die die Todesstrafe gewissermaßen konsumiert, mit der stets erneuerten Genugtuung derer, die in ihr die rechte Entschädigung für zugefügtes Unrecht sehen. Doch Lucy und Mercy trennen offenbar nicht nur diese divergierenden Bewertungen. Die israelische Regisseurin Tali Shalom Ezer hat nicht vergessen, Nebenschauplätze in den Grundkonflikt einzuweben. So steht Lucys auf sich allein gestellter Geschwisterbande Mercys wohlgeordnete Familienkonfiguration gegenüber, dem alten Wohnmobil der Morrows das blitzeblanke Wohnmobil der Bromages, dem humorvollen Umgang miteinander ein Eindruck von Steifheit und Disziplin. Mercys Welt strömt Ordnung und Stabilität aus, eine Ordnung, die bewahrt werden muss und deren Störung aufs Äußerte bestraft werden soll.
Gleichmacherei

Die zwei Welten, die sich in diesem ersten Blick gegenüberstehen, sind bald nur noch zwei Gesichter, denn in Lucy und Mercy findet der Film das Gesicht des Für und das Gesicht des Wider. In den beiden gleichaltrigen Kontrahentinnen bündelt er Argumente, Einstellungen, Erlebnisse der jeweiligen Bewegung, er verleiht ihnen eine Form von Gleichwertigkeit: Jede stützt sich auf ihre eigene dramatische Erfahrung, jede spricht im Namen dessen, was sie für Gerechtigkeit hält. Ihr jeweiliger Aktivismus zwingt ihnen auch denselben Lebensstil auf: Seinen Rhythmus findet der Film in einer Abfolge von Hinrichtungen, die Gegner und Befürworter der Todesstrafe in Wohnmobilen quer durchs Land treibt und immer wieder aufs Neue vor den Toren einer anderen Haftanstalt zusammenbringt.

Bezeichnend ist, dass die Kamera – die sich ohnehin wenig für die kollektive Dimension dieses Aktivismus interessiert, sondern an ihren beiden auserkorenen Repräsentantinnen haften bleibt – nicht an der Rekonstruktion des Konflikts interessiert ist. Sie fängt nicht zwei säuberlich voneinander getrennte Parteien ein, die durch Schuss-Gegenschuss-Sequenzen auch bildlich einander gegenübergestellt werden, sondern sie mischt sich unter die Aktivisten, verwischt die Grenzen, macht sie gleich: Alle halten Transparente hoch, alle rufen ihre Slogans, Für und Wider vereinigen sich zu derselben unaufhaltsamen Kraft der eigenen Überzeugungen.
Was fucking sucks

Der eigentliche Konflikt, so ahnen wir, als Mercy unerwartet die Rolle der Troublemakerin einnimmt und Lucy als erste einen unverhohlen gierigen Blick zuwirft, wird im Duell ausgetragen werden, in der sich anbahnenden Liebesbeziehung zwischen den beiden. Doch tatsächlich bleibt er aus. Allerlei steht diesem Verhältnis im Wege, angefangen bei Lucys nachvollziehbarem Grimm – ihrem inhaftierten Vater steht die Todesstrafe bevor – und dem sich verfestigenden Eindruck, dass Mercy mit ihrem selbstbewussten Umgarnen auf ein Ausscheren aus ihrem verkrampften Hause aus ist – eine Verkrampfheit, die der präzise zusammengefaltete und auf die Bettkante abgelegte Schlafanzug ihres ex nihilo auftretenden Freunds wunderbar illustriert. „Who you are the rest of the time fucking sucks“ – verstehe: wenn wir uns nicht gerade unmittelbar in der Nähe von Hinrichtungen aufhalten –, platzt es aus Lucy heraus, als ihr Blick mit Abscheu an ebendiesem Schlafanzug haften bleibt. Es geht also nicht um die Todesstrafe, es geht um Mercys Lebensstil, um ihre aufstrebende Karriere als Junior-Anwältin, um das bourgeoise Haus ihrer Eltern, um den Eindruck spießiger Konformität, der sie umgibt. Und so wirkt das Todesstrafen-Setting als seltsamer Platzhalter, liefert lediglich Ort und Zeit der Wiedersehen sowie den Kokon aus Traurigkeit, in dem sich Lucy eingesponnen hat und den Mercy erstmal durchdringen muss. Mercy, die ihrem Namen hier, im Privaten, nicht im Politischen, alle Ehre macht: Ihre Barmherzigkeit gilt nicht den Todgeweihten, sondern Lucy, in dessen schwierige Lebensverhältnisse sie zeitweise Wärme und Hoffnung zu bringen vermag.
Die Hinrichtung als Spektakel

My Days of Mercy wird eröffnet mit einer Szene, in der Lucy gedankenverloren den Türknopf in der Autotür unablässig eindrückt und herauszieht. Es ist eine Szene, die sich irgendwann in die Erinnerung drängt, als nämlich klar wird, dass sie die Unbarmherzigkeit, die Schnelligkeit, die Mechanik, die Endgültigkeit der Ausführung der Todesstrafe vorausnimmt. Der Film geht progressiv vor. Zunächst lässt er den Zuschauer vor den Toren der jeweiligen Haftanstalt, verweigert ihm den Zutritt. Lediglich das letzte Mahl des zum Tode Verurteilten wird eingeblendet, samt Name, Haftanstalt und Verbrechen; Humanisierung und Dehumanisierung zugleich. Die aufgeheizte Stimmung vor den Toren, die Rufe, die Transparente erwecken den Eindruck eines erwarteten Spektakels; ein Versprechen, dem sich der Film nicht verweigert, sondern das er einlösen wird, in einer Szene, die befremdende Ähnlichkeit mit einem Kinobesuch hat. Das, was wir sehen, ist wahrlich ein Film im Film, doch My Days of Mercy hat wenig übrig für die Frage nach der Darstellung der Todesstrafe. Der Film verschreibt sich ganz der vermeintlich großen Frage nach den Differenzen, die Liebe überbrücken kann; doch selbst da ist ihm die Todesstrafe eigentlich egal.
Neue Kritiken

Ella McCay

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

No Other Choice

Ungeduld des Herzens
Trailer zu „My Days of Mercy“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (13 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.