Mother! – Kritik
Darren Aronofskys neuer Film über die Heimsuchung einer kontrollsüchtigen Hausfrau beginnt als Kammerspiel-Horror über Verlustängte und mutiert dann zu einer wuchtigen Allegorie über Liebe, Schöpfung und Familie.

Mit einem Augenzwinkern, das jeder verstand, sang Johanna von Koczian einst in ihrem Schlager Das bisschen Haushalt von der Ignoranz der Männerwelt gegenüber dem Hausfrauendasein. Ob es sich ums Kochen handle, ums Wäschewaschen oder die Pflege des Gartens, all das sei ja keine richtige Arbeit und erledige sich eh von allein – sagt zumindest der Mann. Auch Darren Aronofskys neuer Film Mother! widmet sich einem solchen Lebensentwurf; genauer gesagt einer jungen Frau, deren Welt nur bis zur eigenen Haustüre reicht. Anachronistisch wirkt das im Jahr 2017 nur, wenn man angesichts der vermeintlich starken und unabhängigen, tatsächlich aber ebenso innerhalb ihrer eigenen Grenzen gefangenen Protagonistinnen im aktuellen Kino vergisst, wie viele Frauen sich auch heute noch für diesen Weg entscheiden. Für Aronofskys Heldin hat er in eine Sackgasse geführt. Während der eitle Schriftsteller-Mann (Javier Bardem) mit einer Schaffenskrise kämpft, hat sich bei ihr ein zwanghafter Ordnungssinn entwickelt, durch den jeder noch so kleine Kontrollverlust als schmerzhafte Erschütterung wahrgenommen wird.
Die Psyche sichtbar machen

In Filmen wie The Wrestler (2008) und Black Swan (2010) hat Aronofsky mit den Mitteln des Body Horrors erzählt, wie sich Körper und Geist seiner Figuren zu zersetzen drohen. Man könnte die Geschichten des abgehalfterten Wrestlers und der ehrgeizigen Ballerina ebenso als sozialrealistische Dramen über sportlichen Leistungsdruck, dysfunktionale Familien und innere Dämonen inszenieren. Auch wenn es manchmal wirkt, als würden die Protagonisten von einer geheimnisvollen äußeren Macht geleitet, interessiert sich Aronofsky vor allem für ihre zerrüttete Seelenwelt, in die er regelrecht einzudringen versucht. Weil das aber eben nur bedingt möglich ist, versucht er sie zu materialisieren, zu zeigen, wie der Verlust des Selbst seine Spuren in Form von Wunden und Mutationen hinterlässt.
Obwohl die Kamera in Mother! ganz nah an der Figur von Jennifer Lawrence dran ist und ihre steigende Verunsicherung festhält – nachdem ein ungebetener Gast (Ed Harris) an der Tür klopft, der im Laufe der Handlung immer mehr Verstärkung bekommt –, stehen diesmal weniger die Verletzungen der Heldin im Vordergrund als die des Heims. Das Zuhause funktioniert dabei selbst wie ein lebender Organismus, hinter dessen Wänden ein Herzschlag pocht und auf dessen Dielen sich klaffende Wunden bilden. Letztlich übernimmt aber auch das Haus nur eine Stellvertreterfunktion für seine Besitzerin. Seine Fassade beginnt immer dann zu bröckeln, wenn ihr die Kontrolle entgleitet.

Mother! stellt den Rückzug ins Private als Sisyphusaufgabe dar. Der Wunsch, sich von der Außenwelt abzuschotten, in seinem Zuhause zu verkriechen und den eigenen Mann ganz für sich zu haben, bleibt hier unerfüllt. Zunächst scheint es, Aronofsky habe das ultimative Hausfrauen-Melodram gedreht, einen Film, der die ganze tragische Dimension einer Existenz erfasst, in der es keine Trennung mehr zwischen Lebens- und Arbeitsraum gibt. Allerdings sind die Ambitionen des Regisseurs letztlich größer als die Fähigkeit, sie in eine interessante Form zu bringen, das „Was“ wichtiger als das „Wie“.
Die Welt mit großer Geste erklären

Bisher schien sich Aronofskys Werk in zwei Bereiche zu teilen: Die betont düsteren Filme über Selbstentfremdung, in denen die Wahnvorstellungen der Figuren häufig von den Bildern Besitz ergreifen, und die epischeren, mythisch aufgeladenen Stoffe wie The Fountain (2006) und Noah (2014), die nicht selten als esoterisch verlacht werden, mit ihrem Sinn fürs klassische Erzählen und ihren zeitgemäßen Interpretationen archaischer Stoffe aber vielleicht sogar die interessanteren Filme des Regisseurs sind. In Mother! scheinen diese beiden Strömungen nun zum ersten Mal zusammenzulaufen. Was wie ein kammerspielartiger Horrorfilm über Verlustängste beginnt, mutiert zu einer immer abgedrehteren und irgendwann nur noch allegorisch zu entschlüsselnden Geschichte über Ur-Themen wie Liebe, Schöpfung und Familie.
Die Seelenwelt der Protagonistin tritt dabei zunehmend in den Hintergrund. Hier soll es um mehr als nur ein individuelles Drama gehen – das legt nicht nur das inmitten einer Naturlandschaft isolierte und damit jeglichem gesellschaftlichen Kontext beraubte Landhaus nahe, sondern auch die Entscheidung, den Figuren so archaische Namen wie „Mother“, „Him“, „Man“ und „Woman“ zu geben. Hat man erst einmal begriffen, dass sich der Film nur solange für seine Handlung und Figuren interessiert, wie sie Symbole für etwas Größeres sind, steckt man auch schon mitten im reichlich selbstgefälligen Gedankenspiel eines Regisseurs, der die Welt mit großer Geste erklären will, ohne irgendeine interessante Antwort parat zu haben.

Alles, was den Film an Brüchen in der Plausibilität interessant machen könnte, überrollt Aronofsky mit seinem Symbolwillen. Nicht eine Beziehung und eine Frau sollen im Zentrum stehen, sondern die Liebe und das Weibliche. Das ist gedanklich und visuell zwar mitunter auch reizvoll. Aber wie der Film ein Fass nach dem anderen aufmacht, anstatt bereits Etabliertes zu ordnen und weiterzuentwickeln, wie er plötzlich auch noch über hysterisches Fantum philosophiert und eine etwas hanebüchene Verbindung zwischen biologischer und künstlerischer Fruchtbarkeit zieht, all das ist bald eher ermüdend als herausfordernd. Dass Mother! sich zunehmend von narrativer Geschlossenheit und rationalen Erklärungen löst, um in eine mit Science-Fiction-Motiven, Kriegsszenarien und Bibelanleihen durchsetzten Sphäre aufzusteigen, bedeutet nicht, dass er sich von irgendetwas befreien würde.
Neue Kritiken

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho

Die Spalte
Trailer zu „Mother!“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (7 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Hotmadrasi
Treffend formuliert, vielleicht hier und da etwas gnädig (inspiriert von ikonographisch anmutendem Filmplakat) . Zum Glück habe ich den Streifen nicht im Kino gesehen, denn das Verlassen desselben kam für mich schon seinerzeit bei lang ersehntem The Fountain nicht in Frage. Jetzt schalte ich einfach ab als wäre nichts gewesen und streiche das ehemalige Wunderkind gänzlich von meiner Liste; so etwas mit dieser Besetzung hinzubekommen ist schon unglaublich, behilflich dabei: faszinierend stupide Dialoge, das Drehbuch allein schon ein Fall für den Mülleimer; es sei denn es handelte sich um einen rein satirischen Text. Das Erschütternde in diesem Fall ist die schonungslose Ernsthaftigkeit mit der A. sein Werk inszeniert, allein bei seinem Frauenbild (trotz rauchiger Heiserkeit in Jennifer Lawrences Stimme) fehlen einem einfach die Worte. Kein einziger der unzähligen, willkürlich daherkommenden Effekte, die man bereits zu genüge ausnahmslos kennt und die sich darüber hinaus nicht als Zitate zu verstehen geben macht einen tieferen Sinn, obwohl die übrigen Filmschaffenden ihren Aufgaben durchaus gewachsen zu sein scheinen. Einzig A. sollte vielleicht gänzlich ins Prod. Dept. wechseln und weiterhin so unverzichtbare Produkte wie Aftermath (2017) ermöglichen anstatt unsere Zeit, unser Geld und nicht zu vergessen unsere Nerven mit pseudoreligiösen Symbolismen überzubeanspruchen. . (Arbeitstitel des Films war ursprünglich bestimmt „Baby?!“)


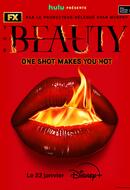



















1 Kommentar