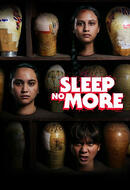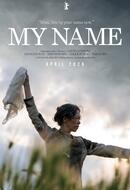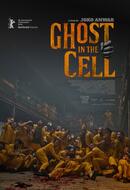Memoiren einer Schnecke – Kritik
Pinky's Pity-Pit – Der Name ist Programm. Mal tränenreich, mal komisch ist die Knetwelt voller skurriler Figuren, auf deren Leben Adam Elliots Memoiren einer Schnecke vom Garten aus blickt.

Ein schwarzer Grund ist die Höhle, aus der die Kamera zurückfährt, nachdem sie zuvor, inmitten einer Kompostlandschaft voller Müll und Memorabilia, in ein Schneckenhaus hinein geflogen war. Diese Höhle ist der Mund einer alten Dame mit runzeligem Gesicht, riesiger Brille und roten Kirsch-Ohrringen, die auf den Namen Pinky hört. Laut stöhnt sie auf. Ein röchelnder Laut, ihr finaler Atemzug, er gehört in der Bewegung der Stop-Motion zu diesem Mund, auch wenn die Stimme nicht diesem, mit einem Mal regungslosen Körper aus Knete und Draht entspringt.
Dem Stil dieser Figur entspricht, dass sie sich noch einmal im Bett aufbäumt: „the potatoes!“ Die Perspektive wechselt von Pinkys Ausruf (besser im Australischen: Jackie Weaver) zur zögerlich, betrübten Nachfrage der wimmernd ihre Hand haltenden, jüngeren Grace Pudel (nicht kindisch: Sarah Snook). Der Film kehrt später noch einmal zu diesem Moment zurück, klärt eine Erinnerung und erzählt dabei mehr als nur eine Lebensgeschichte.
Schnick, Schnack, Schnecken

Schnecken gibt es gleich einige im Film. Allesamt aus Knete. Die Porzellan- und Ton-Schnecken, die Grace, mit ihrer vererbten Schneckenvorliebe sammelt, oder die Familie von Haustieren, die mit ihrem Gehäuse auf dem Rücken im Einwegglas kriechen. Die sprichwörtliche Langsamkeit der Schnecke passt gut zum arbeitsaufwendigen Produktionsprozess des australischen Autors und Regisseurs Adam Elliot, dessen letzter Stop-Motion-Langspielfilm Mary and Max schon ganze 16 Jahre zurückliegt.
Zum Sinnbild der Einsamkeit wird die Schnecke spätestens, wenn Grace wiederholt aufgefordert wird, sich nicht zu verkriechen. Grace, die ihre Schneckenaugen immer auf dem Kopf trägt, in der Form einer Mütze mit zwei daran befestigten Jonglierbällen ihres Vaters. Sie legt selbst ein Verwandtschaftsverhältnis zu den Tieren nahe, wenn sie davon spricht, dass die Schneckenmutter bei der Geburt üblicherweise stirbt. So wie ihre eigene Mutter. Von deren Grabstein, 1972 steht darauf, das Geburtsjahr Elliots, kippt tot eine Schnecke, es bleibt ein Haufen Eier. Ganz gleich wie es sich tatsächlich mit der Fortpflanzung zwittriger Schnecken verhalten mag: in der Welt von Grace ist das ein stimmiger Fakt. Die Schnecken wiederum bleiben stumm und können nichts dazu sagen.

Das Erinnerungsbild ist eines von vielen Details aus der Lebensgeschichte, die Grace ihrer Lieblingsschnecke Sylvia, benannt nach Sylvia Plath, erzählt. Zentral ist für diese Geschichte das, was sie mit ihrem feuerbegeisterten Zwillingsbruder Gilbert verbindet - oder von ihm trennt. Eine Serie von Schicksalsschlägen nimmt bereits im Bauch der Mutter ihren Lauf, wenn die beiden, dort gemütlich eingeschlossen, das erste Mal durch die plötzliche Geburt von Grace auseinander gerissen werden. Ähnlich ergeht es ihnen nach dem Tod des an den Rollstuhl gefesselten Vaters: Bruder und Schwester wachsen in Canberra und Perth bei unterschiedlichen Familien auf.
Liebenswerte Außenseiter
Künstlich flüssige Tränen kullern mehrfach über Graces Wangen und bilden, nicht zum klobigen Körper gehörend, einen ganz eigenen Stoff in dieser Knetwelt. Sie sind wie das geteilte Herz, das gezeichnet einmal zwischen den Zwillingsgeschwistern schwebt. Der Anblick der Tränen prägt das Verhältnis zur Figur ebenso, wie jener Garten, in dem Grace die Schnecke Sylvia frei und ihre Lebensgeschichte Revue passieren lässt. Der sprechende Name des Gartens: Pinky‘s Pity-Pit. Dieser Ort macht es später möglich, dass eine perfide Begegnung von Grace als innerfilmische Slapstick-Knetanimationsszene verarbeitet wird.

Pinky, die keinen Nachnamen hat, wie Cher oder Liberace, ist eine wahre Exzentrikerin. Ihre stoische Gelassenheit ist wesentlich für Memoiren einer Schnecke und den komischen Tonfall des Films. Er kennt nur skurrile Figuren mit Schrulligkeiten und Verschrobenheiten, voller Laster, alles Normale bleibt außen vor. Eliotts Australien wird von typischen Außenseitern bewohnt, mit denen das Kino seit jeher vertraut ist, nicht zuletzt dank der Filmwelten Burtons oder Jeunets. Dabei sind alle diese mehr oder weniger einzigartigen Figuren, auch jene, die sich fies oder ungerecht verhalten, liebenswert gestaltet. Ihre Beziehungen im Film, auch die zum Bully oder Peiniger, sind vom Individuum her gedacht. Darin lauert die Einsamkeit und keimt gleichzeitig ein intimes Potential. Gemeinschaften gibt es vor allem bei den Adoptivfamilien, in die die Zwillinge geraten: eine christliche Sekte auf einer Farm und Nudisten, die schließlich nach Schweden auswandern, in eine Kolonie, in der möglicherweise auch Harvie Krumpet seinen Platz gefunden hätte. Jedem in seinen Eigenheiten zu begegnen und das Leben in vollen Zügen zu leben, ist eine Haltung, die der Film, der manchmal zündelt und zürnt wie Gilbert und häufig sammelt und hortet wie Grace, an Pinky knüpft. Man sollte aber auch Pinky nicht immer beim Wort nehmen.
Geschlossene Farbwelt, mit roten Spritzern

Von Anfang an gesetzt ist das Farbschema: die dominanten Schwarz-Grau-Weiß-Töne, die Beige-Ocker-Braun-Varianten und entscheidenden Rot-Akzente. Da ist die übergroße Brille Pinkys oder der knallrote Apfel, massenhaft produziert, angebetet und ein Inbegriff der Sünde. Rot spritzt es auch später, wenn Gliedmaßen abgetrennt werden. Rot ist das geteilte Herz, das zwischen den beiden Zwillingsbabys schlägt. Und rot färbt sich am Ende der Himmel, wenn der Film zu einem Ort der Kindheit zurück kehrt.
Neue Kritiken

Ella McCay

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

No Other Choice

Ungeduld des Herzens
Trailer zu „Memoiren einer Schnecke“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (14 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.