Mank – Kritik
In Mank verknüpft David Fincher die Frage nach der Urheberschaft des Citizen-Kane-Drehbuchs mit der Frage nach der Inspiration des Autors – und eine umstrittene These mit einer unbelegten. Das macht den Film noch reizvoller als sein Look.

Sich das Wahlergebnis schönzusaufen gelingt ihm nicht. Die Zählerstände für Republikaner und Demokraten verschwimmen gnädig mit Bildern der Wahlparty und immer tieferen Blicken ins Glas, aber am Ende liegt der Kandidat, auf den er alles gesetzt hat und der von einem reaktionären Medienkonzern als Kommunist verunglimpft wurde, doch unrettbar zurück. Wir schreiben das Jahr 1934, für das Amt des kalifornischen Gouverneurs kandidiert der Schriftsteller Upton Sinclair, der Besitzer des Medienkonzerns heißt William Randolph Hearst, und der Wahlpartygast, der sich das Ergebnis nicht schönsaufen kann, ist ein Drehbuchautor in Hollywood, der hierin die Inspiration für sein bekanntestes Werk finden wird. Dass Hearst das zentrale Vorbild für die Titelfigur von Citizen Kane (1941) war, ist bekannt. Dass Herman J. Mankiewicz’ kreativer Stachel im Fleisch hierfür die sabotierte Sinclair-Wahl war, ist eine spektakulär spekulative These von David Finchers neuem Film Mank, die diesen zugleich in die Gegenwart öffnet.
Nicht ohne Alkohol

Die Frage, warum dieses Drehbuch so wurde, wie es ist, treibt den Film um, die Frage nach der Urheberschaft ist für ihn ausgemacht. Bei der Oscarverleihung 1942 im Los Angeles Biltmore Hotel, eine kurze Szene am Ende des Films, wird Mankiewicz’ Name, den Credits entsprechend, als Erster genannt und steht für einen Moment alleine im Raum. Der Name des zweiten Preisträgers, Orson Welles, wird erst nach einer Kunstpause in den schon vorher aufbrandenden Applaus nachgeschoben. Wenn es nach Finchers Film ginge, könnte er darin ganz untergehen, ganz im Sinne von Pauline Kael, die in ihrem gegen die Auteur-Theorie zu Felde ziehenden, allerdings selbst heftig umstrittenen Essay „Raising Kane“ Welles jede Beteiligung am Drehbuch absprach. (Der Mank-Vorspann selbst ehrt Finchers bereits 2003 verstorbenen Vater Jack mit dem alleinigen Script-Credit, ein erstes Statement, schon bevor die Handlung einsetzt.)

In der Rahmenhandlung von Mank, die die Entfaltung des Schreibprozesses studiert, beschränkt sich die Beteiligung Welles’ (Tom Burke), des „Wunderkinds aus New York“, auf telefonische Erkundigungen nach dem Stand der Dinge. Der nach einem Autounfall lädierte Mank liegt mit eingegipstem Bein auf dem Bett, in einem Häuschen in der Mojave-Wüste, in das er sich, fernab vom Hollywood-Betrieb, zur Arbeit verschanzt hat, unter der Obhut der strengen britischen Sekretärin Rita (Lily Collins) und der nachsichtigen jüdischen Pflegerin Frieda (Monika Gossmann) – ein Trio, dessen Dynamik fein austariert wird (und in dem sich auch Zeitgeschichte zusammenwürfelt; Ritas Mann kämpft jenseits des Atlantiks gegen Deutschland, aus dem Frieda mit Manks Hilfe emigrieren konnte). Zu den Bedingungen, unter denen sich Manks Kreativität entzünden kann, gehört nicht zuletzt sein Alkoholkonsum. Welles’ Plan, den abhängigen Mank mittels mit Schlafmittel präparierter Scotchfläschchen nicht vor Feierabend trinken zu lassen, geht jedenfalls nicht auf: Erst als Mank den Inhalt, unter Protest von Rita, unterstützt von Frieda, gegen ungepanschten Stoff austauscht, kommt der für den Endspurt nötige Flow.
Digitale Hommage statt Nostalgie

Sein erster Gegenleser John Houseman hält das Werk für vielversprechend, aber für zu kompliziert – und zählt just jene Eigenheiten auf, die Citizen Kane später berühmt machen sollen. Mank selbst übernimmt denn auch dessen Prinzip, das Rätsel um seinen Gegenstand mittels ausgedehnter Rückblenden sukzessive zu lösen. So verlässt der Film immer wieder die kammerspielartige Schreibsituation, um Mank in weiträumigen und höchst betriebsamen Sequenzen durch das Hollywood-Studiosystem der 1930er Jahre zu folgen und zu ergründen, was ihn dazu brachte, sich in seinem Drehbuch mit Hearst (Charles Dance) anzulegen.

Finchers Freude daran, als ein später Nachfahr die zwischen Writers Rooms und Studiobauten pulsierende Traumfabrik mit allen eigenen technischen, inszenatorischen, stilistischen Finessen zu erkunden, ist hoch ansteckend, und doch ist diese Erkundung keine Nostalgie. Schon auf ästhetischer Ebene nicht, für die bereits die altmodischen, aber zugleich digital verräumlichten Lettern des Vorspanns paradigmatisch sind. Der Film lässt die an Citizen Kane angelehnten tiefenscharfen Bildkompositionen in digitalem Schwarzweiß lumineszieren, den Bernard Herrmann würdigenden Score von Trent Reznor und Atticus Ross von modernen Sounds unterwandern.
Der Autor als Hofnarr

Zwar wenden sich die stets mit Namen und Referenzen gefüllten Hollywood-Szenen dann, zumindest auf lexikalischer Ebene, vor allem an filmhistorisch Eingeweihte. Doch auch unabhängig davon, ob man zu jedem durchs Bild laufenden Schauspieler, Autor, Produzenten den richtigen Kontext abrufen kann, erhält man einen wenig glorifizierenden Einblick in die kollektiven Kreativitätsverwertungsprozesse, in denen einem Autor wie Mank nur eine undankbare Rolle bleibt. Gary Oldman spielt diesen Mann als einen, dem der Suff zwar oft die Gesellschaftsfähigkeit, aber selten Verstand und Sinne trüben kann. Er scheint geachtet, für seinen sarkastischen Witz auch gefürchtet, und bekommt doch immer wieder zu spüren, dass er ein Hofnarr ist, der „Affe des Leierkastenmanns“ (Hearst), der sich selbst irrtümlich für den Antreiber hält.

Seine einzige Verbündete in dem Zirkus wird die Schauspielerin Marion Davies (Amanda Seyfried), Hearsts zeitweilige Geliebte, doch dass sie eben nicht das Vorbild für die talentlose Opernsängerin Susan in Citizen Kane sei, dies zu betonen legen sich Film und Protagonist gleichermaßen ins Zeug. Ihr gemeinsamer Spaziergang durch Hearsts Privatzoo, bei denen die beiden als einander verstehende Verkannte zarte Bande knüpfen, ist eine der schönsten Szenen des Films. Zuvor waren sie beim Gesellschaftssmalltalk auf dem opulentem Anwesen – dem Vorbild für Kanes Schloss Xanadu – die einzigen, die die Gefahr des im fernen Deutschland gerade zur Macht gelangten Diktators erkannten, der von Hearst als Eintagsfliege abgetan wurde. Die Ereignisse in Europa, und wie die Figuren sich dazu positionieren, durchziehen als mahnvolle Einsprengsel den gesamten Film.
Sorglose Spekulation

Schon über ihre Einbettung in die krisengebeutelte Depressionszeit, die auch in die Kinolandschaft Breschen schlägt, kann einem die Handlung in diesen Tagen nahegehen, etwa wenn MGM-Boss Louis B. Mayer (Arliss Howard) die in einem Hörsaal versammelte Studiobelegschaft demonstrativ reumütig um Lohnverzicht anhält. Weit über kinoimmanente Aspekte hinaus gegenwartsnah aber ist Mank in dem Strang, in dem er den zentralen Grund für Manks Groll findet: wie Hearst und Mayer den aufstrebenden „Sozialisten“ Sinclair mittels einer Fakenews-Wochenschau, die bürgerliche Wähler verschrecken soll, sabotieren wollen. Den unglücklichen Nachwuchsregisseur (Jamie McShane), der, sich Karrierechancen erhoffend, dieses Werk ausführte und den nach Sinclairs Niederlage das Gewissen plagt, versucht Mank anschließend erfolglos vom Suizid abzuhalten. In einer hypnotischen Szene auf Hearsts Anwesen löst er daraufhin mit einer so sturzbetrunkenen wie scharfsichtigen Hohnrede auf Hearst und Mayer einen Eklat aus, zu dessen Abschluss er vor den Tisch kotzt.

Das Gewicht, das Fincher auf diesen Strang legt, ist umso bemerkenswerter, als die Eckdaten um die Sinclair-Wahl und die Fake-Newsreel zwar stimmen, von einer Verbindung Manks oder auch nur seiner Haltung zu diesem Fall jedoch nichts bekannt ist (die Figur des Nachwuchsregisseurs ist gar erfunden; vgl. dazu etwa hier und hier). Dass ein Film, der sonst so exzessiv um historische Akkuratesse bemüht ist, gerade in seinem inhaltlichen Zentrum selbst eher sorglos mit den Fakten umgeht, könnte man nach Biopic-Maßstäben fragwürdig finden. Doch gerade dank diesem Move, mit dem Mank die Frage nach künstlerischer Kreativität mit der Frage nach der Korrumpierbarkeit von Kunst und der Verstrickung von Medien- und Politikbetrieb verknüpft, ist er mehr als nur eine mit Filmgeek-Wissen angereicherte, als eye candy servierte Rekonstruktion der Vergangenheit, auch mehr als nur eine Würdigung des verkannten Drehbuchautors, die die Auteur-Frage nur verschieben würde. Dieser Move erst macht die Künstlerfigur Mank, die gegen den Betrieb revoltiert, zum auch für unsere Gegenwart relevanten citizen.
Neue Kritiken

No Other Choice

Ungeduld des Herzens

Melania

Primate
Trailer zu „Mank“

Trailer ansehen (1)
Bilder

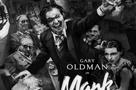


zur Galerie (12 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.
















