Leonora im Morgenlicht – Kritik
Die surrealistische Künstlerin Leonora Carrington wollte nicht Muse, sondern Subjekt des Blicks sein. Leonora im Morgenlicht macht es sich teilweise auf konventionellem Künstler-Biopic-Terrain bequem, entlässt uns aber dann doch versöhnt aus dem Kino.

Mexiko, 1951: Auf einer Bergstraße kommt ein Auto zum Stehen. Eine Frau steigt aus, geht zum Straßenrand und lässt den Blick über das weitläufige, üppig begrünte Tal zu ihren Füßen schweifen. Ihr Begleiter, vermutlich ihr Ehemann, tritt ins Bild, in der Hand eine Kamera. Er will ein Foto von ihr machen. „Not now, darling, please“, wehrt sie ab. Er versucht es erneut, gibt aber schließlich auf. Die Frau hat gewonnen. Erleichtert blickt sie in die Ferne.
„Men look at women. Women watch themselves being looked at“, lautet eine vielzitierte These des Kunsttheoretikers John Berger. Hier der Mann, der aktive Träger des Blicks, dort die Frau, die sich diesem Blick nicht nur aussetzt, sondern ihn sich auch innerlich zu eigen macht. Subtil stellen Thor Klein und Lena Vurma diese These in der Eröffnungssequenz ihres Films Leonora im Morgenlicht in Frage.
Malen und gemalt werden

Leonora im Morgenlicht erzählt die Geschichte einer Frau, die nicht Objekt, sondern Subjekt des Blickes sein will. Basierend auf dem Roman Leonora von Elena Poniatowska haben Klein und Vurma eine Episode aus der ersten Lebenshälfte der Künstlerin Leonora Carrington (1917-2011) verfilmt – von ihren Jahren in Paris und Saint-Martin-d'Ardèche (an der Seite des Künstlers Max Ernst) über ihre Flucht nach Spanien und ihren Psychiatrieaufenthalt in Santander bis zu ihrer Zeit in Mexiko Anfang der 1950er.
Die Handlung beginnt am Ende dieser Chronologie, am Zenit einer schweren Lebens- und Schaffenskrise Leonoras (Olivia Vinall). Von hier springt der Film in das Paris der späten 1930er. Leonora hat ein Verhältnis mit dem Künstler Max Ernst (Andreas Scheer) und kommt mit Vertretern des Surrealismus in Kontakt. Die Episode endet mit Max’ Inhaftierung durch die französische Polizei. (Nach dem Einmarsch der Wehrmacht 1940 stand Ernst als Deutscher im Verdacht, Unterstützer der Nazis zu sein.) Tief erschüttert über die plötzliche Trennung, erleidet Leonora einen Nervenzusammenbruch. Als die Wehrmacht wenige Wochen später Paris erobert, überredet ihre Freundin Remedios (Cassandra Ciangherotti) sie zur Flucht. Nach einem erneuten Zeitsprung begegnen wir der Künstlerin in einer psychiatrischen Klinik in Spanien wieder.
Sex, Drugs und Terpentin

Formal ist Leonora im Morgenlicht, vor allem in seiner ersten Hälfte, ein konventionelles, an den bekannten Klassikern geschultes Künstler-Biopic. Die etwas zu glossy geratenen Bilder von Kameramann Tudor Vladimir Panduru beschwören das Milieu der Pariser Bohème um 1930 – oder richtiger, sie beschwören das, was das Kino in den vergangenen knapp 100 Jahren daraus gemacht hat: Es wird geraucht, getrunken, geliebt und gemalt, während in der Ferne Van-Gogh-Pinien in den Abendhimmel ragen.
Es ist eine Welt, in der das Kunstmachen Männersache ist und in der Frauen als Künstlerinnen nur dann geduldet sind, wenn sie zugleich auch als Musen zur Verfügung stehen. Wer darf malen und wer wird gemalt? Das fragt sich Protagonistin Leonora vor allem mit Blick auf ihre Beziehung zu Max, von dem sie einerseits begehrt, andererseits aber auch als malende Kollegin ernstgenommen werden will. Vinall spielt diese innere Zerrissenheit ihrer Figur mit viel Sensibilität, auch Scheers Ernst-Interpretation ist bestechend. Schwach sind dagegen jene Szenen, die versuchen, die Geschlechterfrage direkter zu adressieren – etwa, wenn der Sexismus eines André Breton entlarvt werden soll. Außer ein paar handzahmen verbalen Spitzen („trotzdem sind es die Frauen, die das Bettzeug wechseln“) fällt dem Film hier wenig ein.
Monströser Realismus

Angriffslustiger – und visuell interessanter – wird Leonora im Morgenlicht erst in der zweiten Hälfte, wenn sich mit der wachsenden mentalen Zerrüttung Leonoras zunehmend surreale Elemente (mit Anleihen an die Bildwelten Carringtons) in die Mise en Scène mischen. Eine Szene sticht heraus: eine Traumsequenz, in der die Künstlerin – in Gestalt einer Hyäne – mit ihrem autoritären Vater abrechnet. Die Kamera verharrt dabei statisch an einem Fleck, während sich Leonoras tierisches Alter-Ego im Bildhintergrund laut schmatzend und kichernd an dem Patriarchen zu schaffen macht.
Das Hyänen-Motiv, eine Reminiszenz an ein Selbstporträt Carringtons von 1938, begegnet uns später wieder. Auch andere Tiere aus den Gemälden der Künstlerin haben Auftritte. Endlich, so scheint es, begibt sich der Film in so etwas wie einen ästhetischen Dialog mit Carringtons Schaffen. Momente eines vielversprechenden magisch-monströsen Realismus blitzen auf. Leider dienen diese Momente nur dazu, Leonoras Realitätsverlust zu illustrieren. In dem Maße, wie sich ihr mentaler Zustand stabilisiert, normalisiert sich auch die Optik des Films wieder. Wir bekommen einen Einblick in die Psyche der Film-Leonora, einen tieferen Einblick in Carringtons Kunst erhalten wir nicht.
An den falschen Stellen leise

Wer darf malen und wer wird gemalt? Für die reale Leonora Carrington hat sich diese Frage nach eigener Auskunft nie gestellt: „I didn't have time to be anyone's muse. I was too busy rebelling against my family and learning to be an artist“, hat sie einmal gesagt. Für das Trotzig-Widerständige, das aus diesen Sätzen spricht, finden Klein und Vurma in ihrem Biopic leider nur selten eine überzeugende filmische Entsprechung. Wo es laut sein müsste, ist es zu leise, und wo es leise sein müsste, ist es zu laut. Meistens.
Dass man dennoch irgendwie versöhnt aus dem Kino geht, verdankt sich vor allem der sehr schönen Schlusseinstellung des Films. Noch ein letztes Mal dürfen wir Leonora beim Malen zusehen. Mit viel Ruhe und sympathisch unprätentiös zeigt der Film hier die vielen kleinen, konzentriert ausgeführten Arbeitsschritte und -routinen, die Leonoras „favorite thing in the world“ ausmachen. Eine zärtliche Liebeserklärung an das Malen und an das Glück, das es bedeutet, sich von den Dingen, die eine*n bewegen, ein Bild machen zu können.
Neue Kritiken

Ungeduld des Herzens

Melania

Primate

Send Help
Trailer zu „Leonora im Morgenlicht“

Trailer ansehen (1)
Bilder



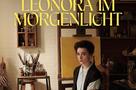
zur Galerie (7 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.










