La Chimera – Kritik
Einbrecher in Platos Höhle: Alice Rohrwacher erzählt in La Chimera in der ihr eigenen naiv-magischen Weise von sympathischen Grabräubern, Europas schlechtem historischem Gewissen und dem Drang, in Vergangenheit und Träume zu flüchten.

Ist das nicht eine wunderbare Drehbuchidee: Arthur (Josh O’Connor), ein hochgeschossener, chronisch schwermütiger Engländer, fällt immer dann in Ohnmacht, wenn er über archäologischen Grabstätten steht. Und davon gibt es viele in der Toskana, wo Arthur aus nicht näher geklärten Gründen gelandet ist. Die Etrusker, die geheimnisumwitterten Vorgänger der Römer, pflegten einen ausgefeilten Todeskult, hinterließen Grüfte, Mausoleen, ganze Nekropolen, oft mit verschwenderischen Beigaben. So ermöglicht Arthurs transtemporale Empfindsamkeit einer kleinen, sympathisch zusammengewürfelten Grabräuberbande rund um den anarchischen Pirro (Vincenzo Nemolato) ein ganz einträgliches Einkommen. Denn der Boden hier ist reich an Artefakten, an Ton, Bronze – und an Geschichten.
Anthropologische Beobachtungen zwischen Wirklichkeit und Fantasie

La Chimera ist ein Palimpsest, ein Film sich überlagernder, mehrfach überschriebener Zeiten. Er spielt in den 1980ern, in einem raueren, ärmeren, archaischeren, mythischeren, in sich gekehrteren Italien als man es in den eher nationalchauvinistischen Zeiten der Ära Meloni kennt. Alles hier hat Patina: Die verschiedenen analogen Filmmaterialien, die fröhlich durchmischt werden, aber ebenso das Set- und das Kostümdesign. Raue, verblichene, grob gewebte Stoffe, verblassende Farben, abblätternde Wandmalereien: Alles wirkt benutzt, getragen, verdreckt, belebt, verbraucht. In all diesen Oberflächen steckt Zeit, und als Zuschauende haben wir Schwierigkeiten, uns zu verorten: Wann sind wir? Alice Rohrwacher zeigt einmal mehr ihre Meisterschaft in filmischer Epochentrickserei. Schon in Glücklich wie Lazzaro[LINK] (2018) konnte sie ausgedehnt von einer Gruppe leibeigener Bauern in einer feudalen, präindustriellen Miniaturgesellschaft erzählen, bis dann plötzlich ein Auto, ein Handy und ein Helikopter auftauchten.

Rohrwacher steht im gegenwärtigen europäischen Kino ziemlich für sich allein. Sie ist zugleich naiv und analytisch, anthropologisch genau und formal und erzählerisch wild. Da sind einerseits teils stark verkürzte, nahezu stereotype Figuren wie der melancholische Arthur, wie die lebensfrohe, aber unstete Italia [sic!] (Carol Duarte), die in ihn verknallt ist, oder die mondäne Kunsthehlerin Spartaco (Alices Schwester und regelmäßige Kollaborateurin Alba Rohrwacher). Da sind viele fast kindliche filmische Experimente wie Überblendungen, Reißschwenks, Slow- und Fast Motion und gekippte Bilder. Und da ist die texturreiche, von gelebter Alltagskultur faszinierte, an kleinsten Details interessierte Beobachtung, eine Art dichter Beschreibung, bei der unklar ist, was der Realität, und was Rohrwachers Fantasie entspringt. Brauchtümer wie ein Hexenumzug am Dreikönigstag, ein Musikkonzert, bei dem man einfach auf die Bühne steigen und mitsingen kann, eine kleine Band, die die Abenteuer der Grabräuberbande direkt in poetische Songs umdichtet; eine Art narcocorrido à la Italiana: Manches davon gibt es sicher auch in der Wirklichkeit, bei manch anderem ist man unsicher, aber alles fügt sich zu einer schlüssigen Welt – was viel mit Hélène Louvarts materialversessener, eigensinniger Kameraarbeit zu tun hat.
Es ist schwer zu beschreiben, ohne kleinteilig zu werden, was La Chimera seine ganz besondere Haptik und Dichte verleiht. So ist dies auch ein Film, an dessen Kleinigkeiten man sich zurecht erfreut. Wie Schatten die Zugkorridore entlangtanzen, wie eine Hand durch die Luft fuchtelt, wie ein paar Vögel auf Schafen reiten, wie sich ein Faden in einer Distel verfängt... Je näher man hinschaut, desto reicher wird der Film.
Ein Posterboy für Europas schlechtes Gewissen

Ebenso wie mit Zeiten kann Rohrwacher gekonnt Realitätsebenen ausfransen lassen. Arthur, der mit Wünschelrute nach dem nächsten Grab sucht, über dem er dann von einem Ohnmachtsanfall ergriffen wird: Man könnte es magisch oder irrational nennen, aber der Film behandelt es ganz faktisch. So ist das halt. Niemand im Film wundert sich darüber. Auch Arthurs Träume brechen immer wieder in die Erzählung ein – er sucht nach seiner verstorbenen Geliebten, die ihn an einem knallroten Ariadnefaden in die Tiefe lockt. La Chimera eröffnet sogar mit einem solchen Traum, der wiederum ganz und gar materialistisch einsetzt. Schwarzbild, kratzende Geräusche, dann wird eine Objektivklappe abgezogen und eine Frau starrt in die Kamera. Eine Hand greift ins Bild, berührt die Frau: POV eines Mannes, der male gaze in Reinkultur. Schnitt auf den im Zug schlafenden Arthur, der von fünf lachenden Frauen beobachtet wird. Schon in dieser kleinen Szene ist eine ganze filmische Blicktheorie angerissen.

Und wie stets hat Rohrwacher ein fast unheimliches Gespür für ungewöhnliche Gesichter, die aus anderen Welten und Zeiten zu stammen scheinen; aus Bereichen außerhalb vertrauter filmischer Repertoires. Gleich nach dem Aufwachen im Zug vergleicht Arthur das Profil einer Frau mit einer antiken Schönheit, und schon da kommt er ins Schlingern, wann und wo er eigentlich gerade ist. Permanent hallen in seiner Psyche die Echos vergangener Epochen nach. Deshalb kann er auf magische Weise Gräber unter der Erde fühlen, deshalb jagt er in seinen Träumen einer Toten nach, und deshalb wird er auch irgendwann heimgesucht von den Geistern derer, denen er und seine Gang die Grabbeilagen geraubt haben. Arthur, der Brite in Italien, er ist ein wahrhaft europäischer Geist: Niedergedrückt von der Last all der angehäuften und halb verarbeiteten Geschichte(n), voll schlechtem Gewissen über die eigenen Taten. Arthur könnte der Posterboy sein für eine Kampagne zur Krise der europäischen Museen, mit ihren zusammengerafften Beständen.
Zurück in die Höhle

Einmal zeigt uns Rohrwacher die unter der Erde schlummernde, noch unangetastete Welt der Artefakte, die versiegelte Vergangenheit. In unwirklichem, unmöglichem Zwielicht ruhen da Vasen, Teller, Särge, kleine und große Figurinen im noch ungeöffneten Grab. Aber schon wird draußen gekratzt, gegraben und gehämmert; und dann fallen die ersten Strahlen der Taschenlampe ins jahrtausendalte Dunkel. Die Menschen können die Vergangenheit nicht in Ruhe lassen. Sie brechen ein ins Grab.

Und da blitzt ein Gedanke auf: Vielleicht geht es in La Chimera auch darum, eines der ehrwürdigsten philosophischen Bilder aller Zeiten umzukrempeln. Platons Höhlengleichnis erzählt ja bekanntlich davon, wie man aus der Welt des Scheins und der Reflektionen heraustreten kann ins gleißende Licht der Wahrheit. Wer einmal draußen war, so erfahren wir, wird niemals mehr zurückgehen wollen. Aber was, wenn es auch die andere Richtung gibt? Den Drang zurück in die Höhle, an deren Wänden Geschichten und Träume flackern? Die blaue Pille schlucken, nicht die rote? Ist das nicht der originäre Wunsch nach Kino?
Neue Kritiken

The Day She Returns

Prénoms

Douglas Gordon by Douglas Gordon

If Pigeons Turned to Gold
Trailer zu „La Chimera“

Trailer ansehen (1)
Bilder
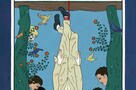



zur Galerie (8 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.













