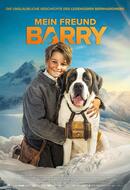Hidden Away – Kritik
Mit „Freude schöner Götterfunken“ über die Felder. In seinem Künstler-Biopic Hidden Away begibt sich Giorgio Diritti auf ein Minenfeld und ist dann am besten, wenn er selbstbewusst in alles hineintritt.

Fast stellt sich schon vor der Sichtung eine Meinung ein, wenn man hört, dass da jemand ein Biopic über einen armen, psychisch und körperlich behinderten, schon immer als Außenseiter lebenden Künstler gemacht hat. Und es wird nicht besser, wenn die Berlinale ankündigt, dass da ein Film ein „visionäres Porträt eines Ausnahmekünstlers“ zeichnet, über einen „revolutionären Einzelgänger der modernen Kunst“ spricht, der durch seine Werke einen „Weg in die Befreiung“ findet. Düstere Vorahnungen richten sich also ein: Das wird ein ganz inspirierender und politischer Film, ein humanistischer Entwurf, der die Außenseiter in unserer Gesellschaft feiert, die gesellschaftliche Repression aus souverän liberaler Position verurteilt und sich selber auf die Fahne schreibt, zum Denken anzuregen – was auch immer das alles heißt.
Selbstbewusstes Psychologisieren

Zweifellos begeht Giorgio Diritti mit seinem neuen Film Hidden Away über den von 1899 bis 1965 lebenden Antonio Ligabue (Elio Germano) ein Minenfeld. Und von einem Film im Wettbewerb erwartet man natürlich, dass da doch etwas „Schlaues“ passiert, dass da so einige Minen durch kluge Inszenierung einfach umgangen werden und sich der Blick auf etwas ganz anderes öffnet als auf das Klischee, nach dem alles klingt. Und doch tritt Hidden Away in seinen ersten Sequenzen gleich mal in so vieles, was sich bei so einem Leben finden lässt. Nur ein Räuspern eines Arztes braucht es, und schon beginnt die Psychologisierung, beginnen die Flashbacks in die tiefe Vergangenheit: Kinder stehen im Kreis um den jungen Antonio, husten ihn abfällig an, der Lehrer hat ihn zur Strafe für sein „abnormales“ Verhalten in einen Sack gesteckt, sagt zu ihm, dass er ein Fehler sei, dass er nicht verdiene zu existieren. Für das Dorf in der deutschsprachigen Schweiz, in das seine Mutter mit ihm ausgewandert ist, ist er mit seinem krummen Gang, seinen schiefen Zähnen und unvermitteltem Geschrei einfach nur ein „wilder Italiener“. Später, als zurück nach Italien abgeschobener Erwachsener, ist er irgendein Deutscher, den die ganze Dorfkneipe auslacht, der in einer runtergekommenen Hütte im Wald lebt.

Natürlich kann da nur die Kunst heraushelfen, die ihm erste Sympathien im italienischen Dorf verschafft. Vor allem in den unschuldigen, ehrlichen Augen der Kinder, für die er Skulptur-Puppen formt, die zuschauen, wie zart er mit den Tieren umgeht. Kunst, die ihm erst noch Lacher von vorbeilaufenden Dorftrotteln einbringt und bald schon erste Bewunderer, erste Kaufinteressenten, von denen er als Bezahlung ein Motorrad verlangt, das ihn zu „Freude schöner Götterfunken“ ganz frei über die farblich saturierten Felder rasen lässt. Und irgendwie funktionieren solche Szenen in der ersten Hälfte dann doch ganz gut: Weil da ein Film so dick aufträgt wie sein pastos malender Protagonist, weil Hidden Away da Minen aus dem Weg räumt, indem er sie explodieren lässt und sein fester Glaube, damit tief sitzende Affekte freizusprengen, etwas eigenartig Rührendes haben kann. Am besten ist der Film, wenn er gar nicht so klug sein will, wie das von ihm vielleicht erwartet wird, und dabei die Perspektive eines Künstlers erzählt, der mit der Welt der großen Kunst, in die er mit steigendem Erfolg langsam eintritt, sowieso kaum etwas anfangen kann. Auf seiner ersten größeren Vernissage steht Ligabue so zwischen Menschen in Smoking und Abendkleid, die den Interpretationen eines Kurators lauschen, bevor er die bildungsbürgerliche Szenerie verlässt und sich zu einem Obdachlosen auf die Straße setzt.
Grob gemalte Figuren

Uninteressante Wege der subjektiven Perspektivierung hat Hidden Away nämlich sonst genug: Eine Kamera, die immer wieder den Blick des Künstlers einnimmt, ein Blick in den Spiegel, auf den im Gegenschuss ein gemaltes Selbstporträt Antonios folgt. Vor allem aber die bildliche Metaphorik: Als Kind steckt sich Ligabue einen Trichter in den Mund, und Diritti inszeniert ihn denn auch konsequent als Produkt einer Gesellschaft, als jemand, der die äußeren Einflüsse fast ungefiltert in sich hineinfließen lässt. Die Mutter erzählt ihm etwa vom Teufel, der durch seine linke Schläfe eingedrungen ist, als Erwachsener wird er sich deswegen immer wieder mit einem Stein gegen den Kopf schlagen.

Vor allem aber fließt in ihn dann doch die Arroganz der Kunstszene: „Ich bin ein großer Künstler, du bist nur ein Fahrer!“, brüllt er seinem Chauffeur ins Gesicht und prahlt mit seinen Preisen. Und auch sein schwieriges Verhältnis zu Frauen, an die er erst Besitzansprüche hat, die er bald gefährlich findet, bald doch vergötternd malt, aber damit immer noch zum Objekt macht, scheint in diesem Prä-68er-Leben nicht von irgendwo herzukommen. Jedenfalls kommt mit diesen Diskursen dann doch so etwas wie ein Kampf gegen eine Inszenierung ins Spiel, die so grell deutlich ist wie die Farben in Ligabues Bildern. Da bleiben dann etwa weibliche Figuren nicht mehr als Ehefrauen, Mütter, lebendige Männerfantasien und Kunstmodelle. Da versucht Hidden Away etwas feiner zu zeichnen, das er mit seinem groben Pinsel gar nicht malen kann.
Neue Kritiken

No Bears

Scarlet

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother
Trailer zu „Hidden Away“


Trailer ansehen (2)
Bilder




zur Galerie (6 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.