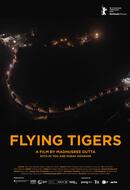Ham on Rye – Kritik
MUBI: Wie eine Sammlung bizarrer Short Stories. Tyler Taorminas Debütfilm Ham on Rye ist ein ebenso unheimliches wie schreiend komisches Jugendporträt aus flüchtigen Momenten und beiläufigen Gesten.

Wer heute einen zeitgemäßen Coming-of-Age-Film machen will, sollte w issen, wann und wie Jugendliche die Wörter cringe und weird benutzen. Beide sind im Internet allgegenwärtig und auf diesem Weg auch in den hiesigen Sprachgebrauch eingesickert. Cringe bezeichnet die körperliche Reaktion auf das, was man im Deutschen Fremdscham nennt, eine Verkrampfung des Gesichts beim Anblick einer fremden Blamage oder der Erinnerung an eine eigene. Weird hingegen erscheinen all die Situationen im Leben, die sich einer klaren Einordnung in den eigenen Werte- und Bedeutungskosmos entziehen. Weird kann ein verstörendes Video sein, auf das man während einer nächtlichen YouTube-Odyssee gestoßen ist, oder das eigentümliche Verhalten eines Mitschülers, der aus dem Rahmen fällt. Dass die beiden Wörter im jugendlichen Sprachgebrauch so inflationär im Gebrauch sind, ist vielleicht kein Zufall: Das Weirde hat in den letzten Jahren auch als literarische Gattung (weird fiction) und sogar als philosophische Kategorie (weird realism) an Popularität gewonnen, und für Kulturkritiker wie Mark Fisher oder Erik Davis entspricht die Kategorie einer Zeit, in der das gesellschaftliche Klima einen zunehmend irrationalen Charakter angenommen hat.
Alltägliche Abgründe in harmloser Ästhetik

Man könnte sagen, dass Taylor Taormina, Regisseur und Co-Autor von Ham on Rye, dem Stellenwert von cringe und weirdness bei heutigen Heranwachsenden gerecht werden möchte, ohne dem Heranwachsen dabei den Aspekt der Leichtigkeit zu nehmen. Dafür bedient er sich einer an David Lynch geschulten Sensibilität für das Abgründige im Alltäglichen und setzt diese effektvoll in eine Spannung zur betont harmlosen Ästhetik des Indie-Films der 1990er Jahre in der Tradition von Wes Anderson, die sich liebevoll an der Verschrobenheit ihrer Hauptfiguren erfreut. Das Ergebnis ist ein episodischer Film, der fast genau in der Mitte zweigeteilt ist und dessen erster Teil andersoneske Niedlichkeit mit lynchesker weirdness würzt, während im zweiten Teil das Verhältnis sich umkehrt und wir in eine Blue-Velvet-artige Kleinstadtnacht eintauchen, in der trotz bedrohlicher Atmosphäre immer wieder schreiend komische und sogar drollige Momente aufblitzen.
Eine Art Real-Life-Tinder

Vignettenartig werden uns im ersten Teil Szenen aus den Partyvorbereitungen einer Gruppe von Jugendlichen kurz vor dem Highschool-Abschluss in einer US-amerikanischen Kleinstadt präsentiert. In seltsam altmodischen Anzügen und Ballkleidern machen sie sich zurecht und brechen in einen noch viel zu sonnigen Nachmittag auf, wobei unterwegs die Natur ruft, Panikattacken ihnen das Fortkommen erschweren und Gedanken an die Ungewissheit der Zukunft und die Größe des Universums sie schwindeln lassen. Immer wieder lässt sich die Kamera von Nebensächlichem ablenken, verliert sich in sonnigen Baumwipfeln oder ruht einige Sekunden zu lange auf den Gesichtern der Protagonisten, um ihre Unbeholfenheit zu betonen. Ein psychedelischer Folk-Soundtrack schafft Übergänge zwischen den Episoden und erinnert uns daran, dass wir uns in Nineties-Indie-Land befinden. Doch im Gegensatz etwa zu Richard Linklaters Dazed and Confused (1993), der ebenfalls einer Gruppe Jugendlicher auf dem Weg zu einer Party folgt, dabei aber eine romanartige Breite entfaltet, lässt Ham on Rye eher an eine Sammlung bizarrer Short Stories denken. Das Jugendporträt, das hier entsteht, ist seltsam atomisiert und besteht aus einer Aneinanderreihung flüchtiger Momente und beiläufiger Gesten.
Passend dazu ist das Ziel unserer Protagonisten keine rauschende Open-Air-Party wie bei Linklater, sondern ein unauffälliges Diner im Stadtzentrum. Die hier erfolgenden Annäherungsversuche zwischen Jungen und Mädchen sind als Abfolge witziger Peinlichkeiten inszeniert, die an die auf YouTube zirkulierenden „cringe compilations“ denken lässt. Aber schon bald wird es unheimlich. Im Rahmen eines seltsamen Rituals bilden die Mädchen einen Kreis und ein Junge nach dem anderen muss vortreten, auf ein Mädchen zeigen, worauf dieses durch Heben oder Senken des Daumens entscheidet, ob sie diesen als Tanzpartner akzeptieren oder nicht. Dieser Art Real-Life-Tinder verleiht der Film durch sphärische Musik eine fast existenzielle Bedeutung, als entscheide dieses harmlose Spiel insgeheim über die Zukunft der Protagonisten. Tatsächlich leuchtet während der folgenden Tanzszene inmitten der jungen Leute ein helles, offenbar übernatürliches Licht auf, das sie zu verzaubern scheint.
Nächtlicher Epilog

Meistens verlassen Highschool-Filme ihre fiktionale Welt an jener schönen Stelle, an der ihre Protagonisten voller Tatendrang eine ungewisse Zukunft erwarte. Doch als die Jugendlichen in Ham on Rye lachend aus dem Diner strömen und hinter einem Hügel im Sonnenuntergang verschwinden, ist Taorminas Film gerade mal bei der Hälfte. Im ausgiebigen Epilog ist die Nacht hereingebrochen, und die jungen und hoffnungsfrohen Protagonisten werden ersetzt durch eine Schar von Figuren, die zuvor nur im Hintergrund sichtbar waren: Es sind die schon etwas älteren jungen Leute in der Stadt, die den Sprung in die verheißungsvolle Zukunft nicht geschafft haben, die, so kann man annehmen, nicht im richtigen Moment im segenspendenden Licht gestanden sind oder bei denen dessen Wirkung schon nachgelassen hat. Sie verabscheuen ihre Jobs, lungern auf Parkplätzen herum, trinken Bier und hören Thrash-Metal, ganz so als wäre noch 1980. Über den Bildern schwebt eine Aura von Frustration und unterdrückter Gewalt. Aber auch diese triste Welt scheint letztlich bewohnbar, und tatsächlich ist sie es, in der viele von uns sich nach unserem eigenen Coming-of-Age-Film dauerhaft einrichten müssen.
Der Film kann man sich auf MUBI ansehen.
Neue Kritiken

"Wuthering Heights" - Sturmhöhe

No Good Men

Die Reise von Charles Darwin

Der große Wagen
Trailer zu „Ham on Rye“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (10 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.