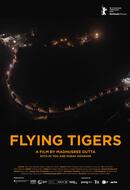Frau Stern – Kritik
In Anatol Schusters neuem Film Frau Stern wuselt eine suizidale Holocaust-Überlebende durch ein schon fast dystopisch vitales Berlin, in dem das Sterben gar nicht so einfach ist.

Vitales, lebendiges, quickfideles Berlin: Alles zugewuselt hier, die Flächen und die Räume. Alles muss bespielt werden, muss belebt sein, darf nicht leer wirken. Nichts also, wo nichts passiert. Skulpturen müssen beklettert werden. Jede Fläche muss besprüht, jeder Späti befüllt sein, jede Bar eine Bühne mit spontaner Auftrittsmöglichkeit haben, jeder dann doch mal leere Raum eine Kunst-Galerie oder Theaterbühne sein. Die Straßen werden wahlweise von Radlerhose tragenden Drogen-Dealern auf Sportrad befahren oder ausgelassenen Huckepack-Rennen der jungen Leute beherrscht. In Anatol Schusters neuem Film Frau Stern ist Berlin eine Stadt, die von tanzenden Wuschellocken, Schnauzern, geraden Ponys und zusammengebundenen Dutts bevölkert wird. Dort, wo alles lebt, und wo alle leben wollen, will die 89 Jahre alte Frau Stern (Ahuva Sommerfeld) endlich sterben.
Noch Utopie oder schon das Gegenteil?
Das dynamische Treiben Berlin wird in Schusters Film nämlich erst wirklich sichtbar im Verhältnis zu Frau Stern und ihrem Todeswunsch. Gleich im ersten Bild sitzt sie ihrem Arzt gegenüber und äußert diesen Gedanken. Der Dialekt ist hebräisch. Die Haare sind ergraut, markante Falten über der Oberlippe, der Blick streng, der Oberkörper ein bisschen gekrümmt, als würde er stets die Last einer ganzen Lebenszeit mit sich schleppen. Aber sterben geht hier kaum, nichts will den Tod bringen. Der Arzt ist zu gutmütig, auf den Schienen scheint kein Zug mehr zu fahren, der Radhosen-Dealer dealt keine Waffen, der Späti-Besitzer auch nicht, selbst das Alleine-in-der-Badewanne-Ertrinken wird von den einbrechenden Nachbarn verhindert und das Rauchen, das hier zum Standardrepertoire gehört, kann auch keine mehr umbringen („Ich hab’ das KZ überlebt, ich werd’ auch das Rauchen überleben“). Frau Stern fühlt sich gerade zu Beginn an wie eine nahe Zukunft Berlins, von der man nicht weiß, ob sie noch Utopie oder schon Dystopie ist.

Phänomenale Vergangenheit
Was derart verschriftlicht nach schematischer Gegenüberstellung von Jung und Alt, Leben und Tod, Einsamkeit und Gemeinschaft und nach zahlreichen Parallelmontagen klingt, ist viel eleganter umgesetzt. Zwar wird reichlich konfrontiert, aber nicht dramaturgisch, zwar wird kontrastiert, aber nicht räumlich und zeitlich getrennt. Frau Stern sieht dem Treiben der Stadt nicht teilnahmslos zu, lebt nicht daran vorbei, sondern ist mittendrin, ist gar unser Verbindungsstück mit dieser Welt. So ist die Seniorin fester Bestandteil der Clique ihrer Enkelin Elli. Sie sitzt beim Huckepack-Rennen auf dem Rücken, lauscht halb betrunkenen Auftritten in Bars, tanzt im Club.

Mit dem komödiantischen Klischee der junggebliebenen Oma hat das aber schon deshalb nichts zu tun, weil der Film ein ernsthaftes Interesse an der phänomenalen Erscheinung des gealterten Körpers hat. In einer der tollsten Szenen ist sie es, die ihr Lieblingslied auf der Bühne einer Bar mit Wohnzimmer-Atmosphäre singt. Die Stimme tief, singt nicht mehr richtig, redet eher ein bisschen kratzig, abgenutzt vom Leben. Die Kamera hält lange auf das Gesicht, schaut dabei zu, wie große Regungen ausbleiben und lediglich die rechte Wange unkontrolliert zu zucken beginnt.

Die Körperlichkeit und das Spiel Ahuva Sommerfelds sind ohnehin der Hauptschauwert des Films. Selbst das Rauchen sieht anders, sieht routinierter aus, erscheint nicht trendy und hip, sondern als etwas das schon immer so war. Ein Körper, in dem mehr Leben steckt als in allen anderen, nur eben nicht als Energie, sondern als verkörperte Geschichte und Erfahrung. Natürlich schwingt da auch die KZ-Vergangenheit mit, wird dann aber vom Film nicht als Hauptmerkmal der Figur behandelt, auf das die müden Gesten, der strenge Blick, die verbrauchte Stimme stetig verweisen müssten. Schuster findet in der Körperlichkeit einen Weg, seine Figur nicht mit ihrer prägenden Geschichte zu bedrängen, sie aber auch nicht einfach zu unterschlagen.
Herrliche Uneitelkeit

Die dokumentarisch anmutende Kamera ist in Frau Stern häufig im Mittelpunkt: Viele Szenen und Dialoge wirken improvisiert, erinnern vereinzelt an den German Mumblecore. Im Gegensatz zu dessen Protagonist Jakob Lass gerät das bei Schuster aber nicht zum manifesten Stil, den der Film gegen mögliche andere Zugänge verteidigen müsste. Zum einen weil die Improvisationstechniken eben nicht so sehr für sich selbst stehen wollen, indem sie Authentizität und Unverkrampftheit betonen. Zum anderen weil dieser Stil auch von geradezu auffällig geschriebenen Dialogen flankiert wird, in denen etwa ein Galerie-Besitzer seine artsy-fartsy-Phrasen scheinbar zusammenhangslos runterplappert. Frau Stern wirkt durch diese Vielfalt herrlich uneitel. Auch die Bildgestaltung verzichtet auf punktgenaue oder gar stylische Ausleuchtung, die mit wenig Aufwand große Effekte erzielen will. Vielmehr sieht man dem Film sein wohl sehr begrenztes Budget an.
Schmierige Karikatur

Einmal scheint sich Schuster aber doch ein bisschen Sorgen um das Antlitz seines Films zu machen. Da ist Frau Stern zu Gast in einer Talkshow. Ein schmierig wirkender Moderator sitzt dort und entlockt den Gästen ihre einzigartigen Lebensgeschichten, was im Falle Frau Sterns bedeutet, ihre Vita auf die KZ-Erfahrung zu reduzieren. Es ist ein merkwürdiger Moment, weil er aus dem so bescheidenen Film herausfällt. Frau Stern karikiert jene ihm entgegengesetzten Erzählstrategien, die Holocaust-Überlebende in ihrer eigenen Erfahrung einsperren, so als gäbe es nichts weiteres, was diese Leben ausgemacht hätte; für einen kurzen Moment vergewissert sich der Film also doch noch einmal seiner selbst. Schmälern kann das Frau Stern aber nicht, weil Schuster bis dahin seine Themen kaum gesetzt, sondern einfach aus den Körpern seiner Darsteller hat fließen lassen. Den eigenen Status durch den expliziten Abgleich mit dem Anderen zu festigen, das hat dieser Film gar nicht nötig. Denn diesen Status erarbeitet er sich ganz wunderbar allein.
Neue Kritiken

No Good Men

Die Reise von Charles Darwin

Der große Wagen

Ella McCay
Trailer zu „Frau Stern“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (7 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.