Emilia Pérez – Kritik
Vom beinharten Kartell-Boss zur einfühlsamen Kämpferin für Gerechtigkeit: Die Heldin von Jacques Audiards melodramatischem Gangster-Musical wechselt zwar Milieu, Identität und Geschlecht, muss jedoch feststellen, dass das gar nicht so einfach ist.

Rita (Zoe Saldana) will als Anwältin in Mexiko City Karriere machen. Wegen ihrer dunklen Haut wird ihr Traum von der eigenen Kanzlei aber, wie sie gleich zu Beginn sagt, ein Traum bleiben. Um sich beruflich behaupten zu können, muss sie deshalb die Zähne zusammenbeißen und unter anderem einen Frauenmörder mit unlauteren Tricks frei bekommen. Geld oder Integrität, sozial aufsteigen oder sich selbst treu bleiben, das ist der Gewissenskonflikt, mit dem Emilia Pérez beginnt. Wenig später wird Rita mit einem Sack über dem Kopf in die Wüste gefahren, um ein zwar nicht minder unmoralisches, jedoch finanziell deutlich ertragreicheres Angebot zu bekommen: Sie soll Kartell-Boss Manitas (Karla Sofía Gascón) nicht nur helfen, seinen Tod vorzutäuschen, sondern ihm auch ein neues Leben als Frau ermöglichen.
Unerschütterlicher Glaube ans Gute

Jacques Audiards melodramatisches Gangster-Musical trennt seine beiden ähnlich zerrissenen Protagonistinnen nach vollendeter Arbeit zwar, führt sie jedoch durch eine gemeinsame Mission erneut zusammen. Als sich Rita und Emilia – wie Manitas nach seiner geschlechtsangleichenden Operation heißt – Jahre später wieder treffen, gründen sie eine Non-Profit-Organisation, die Angehörigen von verschwundenen Kartell-Opfern Gewissheit verschaffen soll. Massenhaft verscharrte Leichen werden von ihnen aufgespürt und identifiziert. Zumindest streckenweise glaubt der Film unerschütterlich ans Gute und lässt die beiden Frauen endlich etwas tun, auf das sie stolz sein können.

Emilia Pérez setzt auf die dramatische Kraft von haarsträubenden Übertreibungen, abenteuerlichen Volten und krassen Gegensätzen. Schon die Wandlung vom bärbeißigen Großverbrecher mit kratziger Stimme und respekteinflößender Gefolgschaft zur empathischen und eleganten Power-Frau könnte größer kaum sein. Männlich und weiblich sind für Audiard keine fließenden Kategorien, sondern widerstreitende Grundprinzipien. Auf der einen Seite Hitzköpfigkeit, Gewalt und Zerstörung, auf der anderen Milde, Vernunft und Wohltätigkeit.
Doch wieder Theater

Dass Emilia in mehrfacher Hinsicht die Seiten gewechselt hat, offenbart sich, als sie ihre spätere Liebhaberin Epifanía (Adriana Paz) aufsucht. Der Tod ihres gewalttätigen, bei einem Gang-Krieg ums Leben gekommenen Mannes ist für sie eine große Erleichterung. Es wird angedeutet, dass auch Manitas ein ähnliches Gemüt hatte. Emilia Peréz beschwört eine Spannung herauf, die durch Widersprüche und Ambivalenzen entsteht. Er zeigt, dass sich eine Identität nicht einfach durch eine andere ersetzen lässt. So spitzt sich der Film immer stärker zum Thriller zu, dessen Heldin von ihrer Vergangenheit eingeholt wird.

Emilias altes Leben wird von ihrer „verwitweten“ Frau (Selena Gomez im gelangweilten Rotzgören-Modus) und den gemeinsamen Kindern verkörpert. Jessi hält ihren Mann für tot und zieht mit dem Nachwuchs bei Emilia ein, die sie für Manitas’ Schwester hält. Dabei nutzt der Film das trans-Sein seiner Heldin für die Handlung; unaufdringlich, aber doch dramaturgisch effektiv. Denn obwohl Emilia endlich sie selbst sein kann, muss sie doch wieder Theater spielen. Und als herauskommt, dass Jessi schon lange eine Affäre hat, sieht man plötzlich auch wieder Manitas’ wuterfüllt herrischen Blick.
Am besten monumental

Emilia Pérez neigt manchmal zu ungelenker Sozialkritik, weiß aber wie man Genre-Momente in Szene setzt und hat zwei starke Hauptdarstellerinnen, die ihren Darbietungen die nötige Wucht verleihen. Zumindest teilweise wünscht man sich aber, Audiard hätte sich die Idee mit dem Musical aus dem Kopf geschlagen. Besonders in der ersten Hälfte des Films sind die musikalischen Einlagen – geschrieben von Komponist Clément Ducol und Sängerin Camille – häufig nur alberner, musikalisch schwungloser Sprechgesang, der so aufgesetzt wirkt, dass er uns aus der Geschichte reißt.

Es gibt aber auch gelungenere Nummern, in denen die Musik tatsächlich die Emotionalität der Handlung weiter zuspitzt. Meist geschieht das bei intimeren und leiseren Szenen, denen die Songs eine einnehmende Zärtlichkeit verleihen. Etwa wenn Emilias Tochter ihren Vater am Duft zu erkennen glaubt und die beiden im Duett eine schier endlose Zahl an markigen Gerüchen aufzählen, oder wenn die Protagonistin ihre erste Nacht mit Epifanía verbringt. Aber auch der Bombast steht Emilia Pérez mitunter gut, beispielsweise die Setpieces, in denen das Volk als mächtiger Chor auftritt. Überhaupt fühlt sich der Film im Monumentalen am wohlsten; seien es die geschmeidigen Cinemascope-Bilder von Paul Guilhaume oder Damien Jalets Choreografien, die die Leinwand regelmäßig in Wallung bringen. Da präsentiert sich der Film mit einem Selbstbewusstsein, das seine Holprigkeiten größtenteils überstrahlt.
Neue Kritiken

AnyMart

Allegro Pastell

A Prayer for the Dying

Gelbe Briefe
Trailer zu „Emilia Pérez“
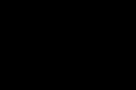
Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (17 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.
















