Elegy oder die Kunst zu lieben – Kritik
Aus Philip Roths Roman über die Macht und den Verfall des Körpers hat Isabel Coixet ein anständiges Beziehungsdrama gemacht, in dem zu melancholischen Klavierklängen stilvoll begehrt und gelitten wird.

„Wenn man mit einer Frau schläft, rächt man sich für alles, was einen im Leben besiegt hat“. Mit einer Betrachtung wie dieser sammelt man beim weiblichen Publikum wahrscheinlich keine Sympathiepunkte. Der Voice-Over-Kommentar des 62-jährigen College-Professors und Kulturkritikers David Kepesh (Ben Kingsley) ist allerdings eine der wenigen potentiellen Anstößigkeiten in Isabel Coixets Adaption von Philip Roths Kurzroman Das sterbende Tier (The Dying Animal, 2001). Dabei könnte der „Professor der Begierde“ noch weitaus mehr solch unverblümter Sprüche vom Stapel lassen, hätten die spanische Regisseurin und ihr Drehbuchautor Nicholas Meyer ihn nicht an die kurze Leine gelegt.

Hinter Kepeshs vordergründigem Sexismus und seinen zahlreichen Affären mit jungen Frauen verbirgt sich die Angst vorm Alter und vorm Sterben. „Mit Sex übt man auch Vergeltung am Tod“, heißt es bei Roth. „Nur dann ist man voll und ganz lebendig (…)“. Coixet hat sich bereits in ihren Langfilmen Mein Leben ohne mich (My Life Without Me, 2003) und Das Geheime Leben der Worte (The Secret Life of Words, 2005) sowie in ihrem Kurzfilmbeitrag zu Paris, je t’aime (2006) unterschiedlich erfolgreich mit den Themen Krankheit und Tod beschäftigt. Im Gegensatz zu Roths Vorlage, die in Monologform ausschließlich die männliche Perspektive wiedergibt, addiert die Regisseurin in Elegy oder die Kunst zu lieben (Elegy) die Sicht der weiblichen Protagonistin Consuela Castillo (Penélope Cruz), die im Handlungsverlauf an Brustkrebs erkrankt.
Mit der 24-jährigen Tochter wohlhabender kubanischer Einwanderer beginnt Kepesh eine folgenschwere Amour fou – nachdem sie als seine Studentin ihre Noten erhalten hat, um eine eventuelle Klage wegen sexueller Belästigung auszuschließen. Die ebenso schöne wie kultivierte Consuela wird zum weißen Wal für den intellektuellen Beziehungsphobiker. Während der sexuellen Revolution der sechziger Jahre hat er Frau und Sohn (Peter Sarsgaard) für seine Unabhängigkeit sitzen gelassen und durchlebt nun, trotz ausgiebig geübter „männlicher Emanzipation“, zum ersten Mal die Qualen der Eifersucht. Gänzlich gefesselt von dem „Kunstwerk“ Consuela, erkennt Kepesh ihr Wesen und ihre Verwundbarkeit erst, nachdem sie ihn verlässt und mit ihrer Krankheit dem Sterben näher rückt als er selbst.

Coixet inszeniert ihren Protagonisten als Gefangenen seiner Bindungs- und Todesängste: Mehrfach blickt er in seiner Wohnung durch ein halbgeschlossenes Rollo aus dem Fenster oder steht reglos und innerlich abwesend zwischen vorbeiströmenden Passanten auf der Straße, wird hinter einen Zaun oder neben Treppenstäben positioniert und immer wieder durch Türrahmen gefilmt. Räume und Kostüme sind in gedeckten Farben gehalten, Liebesszenen finden im Halbdunkel statt und wirken für die Geschichte einer Begierde recht stilisiert. Leidenschaft wird mehr in Worten als in Bildern transportiert. Drehbuchautor Nicolas Meyer, der schon in seiner Adaption von Roths Der menschliche Makel (The Human Stain, 2000) keinen roten Faden für die verschiedenen Handlungsstränge und Zeitebenen entwickeln konnte, lässt auch Elegy zu sehr in Fragmente zerfallen.
Die Verbindung von Eros und Tod behandelt die Regisseurin weitgehend oberflächlich und risikoscheu. Ihr sittsames Beziehungsdrama mit fast konstanter Klavierbegleitung in Moll wird weder den gesellschaftskritischen Bezügen oder den erotischen und emotionalen Forschheiten des Romans gerecht, noch setzt es ihnen eine überzeugende eigenständige Interpretation entgegen. Coixets Entscheidung, die beiden sterbende Tiere zu zähmen und domestizieren, entspringt möglicherweise der Befürchtung, die Hauptfiguren könnten als alter Lüstling und bloßes Sexobjekt missverstanden werden. Also versöhnt sich hier der lang verachtete Vater und insgesamt richtig nette Kepesh mit seinem entfremdeten Sohn, und Consuela unternimmt mit ihrem Liebhaber Strandausflüge, zettelt Grundsatzgespräche über eine gemeinsame Zukunft an oder stellt fest, dass der Kühlschrank leer ist und eingekauft werden muss. Diese abgewandelten Charakterisierungen sind jedoch keine komplexeren oder gar „weiblicheren“ als bei Roth, sondern lediglich konventionellere und gefälligere.

Das Gelungenste an Elegy ist die durchweg stimmige Besetzung, am lebendigsten ist er in seinen komischen Momenten. Wenn Kepesh den Maulkorb ablegen darf und mit seinem besten Freund George (Dennis Hopper) beim Squashspiel oder in der Sauna wie ein hormongebeutelter Schuljunge über die ewigen Nöte mit dem anderen Geschlecht feixt. Oder wenn der liebeskranke Professor im Bett liegt und vom Dichterfreund gefüttert wird – sonst ein echter Chick-Flick-Klassiker, der zurzeit in Sex and the City (2008) zum Einsatz kommt.
Schließlich scheut Isabel Coixets Drama auch in seiner Herangehensweise an die Diagnose Krebs davor zurück, allzu unbequem und schmerzhaft zu werden. Stattdessen bevorzugt die Regisseurin wie in Mein Leben ohne mich die romantisierte Variante. Dabei hätte einem Film, der unter anderem die Vergänglichkeit äußerer Schönheit und den Blick hinter eine blendende Fassade thematisieren möchte, etwas weniger Weichzeichnung vielleicht gut gestanden.
Neue Kritiken

No Bears

Scarlet

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother
Trailer zu „Elegy oder die Kunst zu lieben“

Trailer ansehen (1)
Bilder


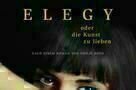

zur Galerie (7 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
der Kritiker
Sensibler Film mit Starbesetzung. Cruz ist der Hammer.
Tina Deplazes
Der Film ist ausdrucksstark und die Musik spielt mit... Die Worte zwischen den Zeilen können auch gespürt werden... Zu einem solchen Film würde auch ich gerne die Filmmusik dazu spielen. T.D.



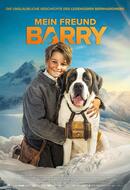














2 Kommentare