Der Phönizische Meisterstreich – Kritik
Wes Anderson liefert auch mit seiner neuen, gewohnt manierlichen Regiearbeit Der phoenizische Meisterstreich, was wir von ihm erwarten. Und doch ist jeder seiner Filme anders. Weil jeder von ihnen auf ganz eigene Weise versucht, das Chaos der Welt qua Organisation zu bezwingen.

Mit einem neuen Film Wes Andersons ist es wie mit einem neuen AC/DC-Album: Wir wissen vorher bereits, was wir erwarten können. Bei AC/DC im Viervierteltakt stampfenden Hardrock, bei Anderson frontale, klar aufgebaute Einstellungen voller Ornamente und skurriler Details, eine lexikalisch durchorganisierte Geschichte und ebensolche Figuren. Erzählt wird kapitelweise, expressiv und gediegen, das alles ist nostalgisch im 20. Jahrhundert verankert und sehr Vintage-mäßig. Kurz: jeder seiner Filme ist auf dieselbe Art manierlich und unverkennbar. Dass Anderson einmal einen stilistisch divergenten Film machen wird, ist nicht abzusehen. So festgefahren ist er, dass er zuweilen heftig an einer Karikatur seiner selbst kratzt.
Stil als Verdrängungsarbeit

Wenn bei Anderson dennoch nicht alles so einfach, nicht so uniform ist, wie es auf den ersten Blick scheint, dann nicht aufgrund der zuweilen eingeschobenen Stop-Motion-Animationsfilmen, die sich im Kern nicht vom Rest des Werkes abheben; und auch nicht, weil jeder Griff in die Vergangenheit jedem Film – in den Grenzen des Anderson’schen Stils – ein unterscheidbares Erscheinungsbild verleiht. Sondern wegen der Verdrängungsarbeit, die mit diesem Stil betrieben wird und die mal mehr, mal weniger gut funktioniert.
Andersons Stil läuft nämlich darauf hinaus, das Chaos der Welt qua Organisation zu bezwingen. Direkt oder indirekt geht es stets darum, sich an Emphasen der Wissenschaft und Kultur zu klammern, hinter denen ein schwarzer, bodenloser Abgrund lauert. Wie wenn ein Kind sich in die kleinen Ordungssysteme von Comics oder Astronomie rettet, um den Stress mit Eltern, Mitschülern und/oder dem Leben auszusperren.
Lebensmüde Depression, existentielle Vereinsamung

Manchmal schmerzt die Verspieltheit der Filme Andersons mit ihrem neurotischen Kitsch, etwa wenn die Oberfläche eines skurrilen Jacques-Cousteau-Pastiche (Die Tiefseetaucher/The Life Aquatic with Steve Zissou, 2004) eine lebensmüde Depression gleichzeitig distanziert und umso intensiver nachzeichnet, oder wenn in der Pfadfinder-Extravaganz Moonrise Kingdom (2012) das Leid einer existentiellen Vereinsamung nicht nur gezähmt wird, sondern in der geordneten Eruption des Films umso dramatischer wirkt. Die Verdrängungsarbeit verleiht dem zu Verdrängenden erst seine Potenz.
Manchmal hingegen verliert sich die grenzenlose Stilisierung und die Filme wirken wie Stilübungen, die den emotionalen Kern hinter all den Schichten von Kunst und Gekünstel verschütt gehen lassen. Asteroid City (2023) war zuletzt mit so vielen Metaebenen, Fußnoten und Querverweisen durchzogen, dass die Atomexplosion des eigentlichen Schmerzes irgendwo am Horizont verblieb und die Schönheit etwas sehr gediegen geriet.
Lücke im Budget

Der phönizische Meisterstreich (The Phoenician Scheme) nun ist stilistisch wieder wie gehabt und überrascht nicht. Konkret verwandelt Anderson Citizen Kane (1941) in eines seiner filmischen Pop-Up-Bücher. Der Mogul Zsa-Zsa Korda (Benicio del Toro) versucht, ein monumentales Staudammprojekt irgendwo im heutigen Syrien und/oder Libanon umzusetzen. Dort, wo einst die Phönizier lebten. Eigentlich ist alles geklärt, nur ist das Projekt nicht fertig finanziert. Also macht sich Korda auf, seinen Geschäftspartnern die Lücke im Budget abzuluchsen.
Seinen nostalgischen Blick richtet Wes Anderson auf eine Kolonialgeschichte, die den Nahen Osten als (wirtschaftliches) Spielbrett betrachtet, das endlose Möglichkeiten für Gewinn, Abenteuer und utopische Selbstverwirklichung bietet, aber auch revolutionäre Gegenbewegungen beherbergt. Auf veraltete, geradezu antike und dubiose Techniken der Spionage und deren Abwehr – von Taschenlügendetektoren bis hin zu Handgranatenwerbegeschenken. Auf den Kampf der USA gegen Kartelle und Wirtschaftsmogule, in dem sich beispielsweise die Entflechtung von Standard Oil andeutet. Auf einen sogenannte „renaissance man“, der sich mit Bildung und Wissen umgibt, um nicht nur ökonomisch zu wachsen – weshalb der Film mit Büchern, Gemälden, Lehrern und Insekten angereichert ist.
Die Komfortzone verlassen

Die Lücke, die der Mogul schließen muss, betrifft nicht nur das Budget, sondern mehr als alles andere die zwischen den Menschen. Nicht nur kämpft Zsa-Zsa Korda darum, mit seinen Geschäftspartnern auf einen Nenner zu kommen und den beständigen Mordanschlägen eines Rivalen zu entgehen. Auch sucht er, der kein Staatsbürger welchen Landes auch immer sein möchte, sondern existentiell nur für sich stehen will, die Nähe zu seiner erstgeborenen Tochter Liesl (Mia Threapleton). Diese möchte bald Nonne werden, Korda aber hat sie als seine Nachfolgerin auserkoren. Der Kontakt mit ihr – und diverse Nahtoderfahrungen – lassen ihn langsam zwischenmenschlich aufwärmen. Der phönizische Meisterstreich ist eben kein wirtschaftlicher, sondern ein menschlicher Coup.
Dramaturgisch folgt diese Entwicklung - wie letztlich immer – einem ziemlich simplen Prinzip und ist rein erzählerisch wenig überraschend. Das Zentrale ist der Stil, die allgegenwärtige Niedlichkeit und Ordnung, die mit Menschlichkeit kämpft, sie auf Distanz hält und sich gleichzeitig nach ihr sehnt. Immer wieder geht es darum, wie einfach es ist, sich auf wirtschaftliche Unternehmungen, sportliche Rivalitäten, göttliche Berufungen oder Insektenkunde zurückzuziehen; dass man sich aber zwangsläufig auch mit den Menschen um einen herum arrangieren muss. Während der Plot erbaulich behauptet, wie einfach es sein kann, sich anderen zu öffnen, erzählt einem der Film in seiner Gesamtheit auch davon, wie schwierig es ist, die eigene Komfortzone zu verlassen – in dieser Verbindung aus direkter Sterilität und indirekter Emotionalität ist Der phönizische Meisterstreich so erfolgreich, wie schon länger kein Film Andersons mehr.
Neue Kritiken

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho

Die Spalte
Trailer zu „Der Phönizische Meisterstreich“

Trailer ansehen (1)
Bilder


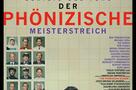

zur Galerie (10 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.













