Der Fan – Kritik
„Skandalfilm“ und popkultureller Seismograph: In seinem bekanntesten Film nimmt Eckhardt Schmidt die TV-Invasion der Neuen Deutschen Welle vorweg und lässt Désiree Nosbusch ihr Objekt der Begierde verschlingen.

„Augenblick … ich lebe für den Augenblick“, skandiert das maskenhafte Männergesicht auf dem Fernsehschirm mit monotoner Stimme. Die 17-jährige Simone, mit ihren Eltern und weit weg von ihnen im Wohnzimmer sitzend, verfolgt den Auftritt des Sängers gebannt und wartet sehnsüchtig auf das „verabredete Zeichen“, ein Zwinkern, um das sie ihn in einem ihrer zahlreichen Liebesbriefe gebeten hat. Leben für den Augenblick – nicht als Aufforderung zum carpe diem versteht das Simone, wie sollte sie das in Ulm, sondern als das Hinleben auf den einen Augenblick, den endlich erwiderten Blick aus den Augen des anderen. Ihr ganzes Dasein, und damit die Fluchtlinie des Films, treibt, stoisch vorangetrieben von den eleganten elektronischen Klängen der Band Rheingold, auf diesen einen Punkt zu.
Schöne, kühle Oberflächen

„Hat Désiree das wirklich nötig?“ So oder ähnlich hieß der Artikel in einer meiner ersten Bravos, der mich mit der Existenz von Der Fan konfrontierte und mir das Bild, wie Désiree Nosbusch hingebungsvoll ein blutverschmiertes elektrisches Küchenmesser ableckt, für immer ins Gedächtnis brannte. Im Text wurde beschrieben, was sie im Film damit tut, dessen Sichtung ich zugleich fürchtete und ersehnte, die für mich mit zehn ein Ding der Unmöglichkeit war. Auf dass der Augenblick niemals enden möge, wird Simone das Objekt ihrer Fanliebe, nachdem sie Sex mit ihm hatte, erschlagen, zerteilen, einfrieren, nach und nach kochen und aufessen und schließlich seine zermahlenen Knochen in alle Winde verstreuen. Wegen dieser Szenen, in denen die damals noch minderjährige Hauptdarstellerin minutenlang nackt zu sehen ist, war Der Fan 1982 der „Skandalfilm“ der Saison, von der Kritik verschmäht und beim Publikum ein Hit.

Als ich den Film Dekaden später erstmals sehe, ist er vom ersten Moment an ein mit Schlüsselreizen überfüllter Container, der eine lang vergangene Zeitstimmung unmittelbar präsent macht, wobei sich Erinnertes mit viel später Angelesenem und Angesehenem unentwirrbar vermischt. Da ist die vorpubertäre Schwärmerei und ein Solidaritätsgefühl mit der Hauptdarstellerin, die damals oft mit der Spießervokabel „respektlose Göre“ bedacht wurde und mit diesem Film ihren guten Ruf offenbar endgültig ruiniert hatte. Da ist ein vages Unbehagen über eine Atmosphäre (nicht nur) medialer Gewalt – eine Erinnerungsspur führt zu einem ein Jahr später erschienenen Stones-Song namens „Too Much Blood“, der von einer ganz ähnlichen Bluttat handelt (tatsächlich hat sich der darin besungene Killer später als Fan von Schmidts Film bezeichnet). Da ist die magische Anziehungskraft der Neuen Deutschen Welle und ihrer schönen, kühlen Oberflächen, die damals wie aus dem Nichts über die noch in restaurativer Gemütlichkeit schlummernde bundesdeutsche TV-Landschaft hereinbrach.

Der bereits 1981 gedrehte Film war hier seiner Zeit sogar voraus: Noch bevor die NDW-Invasion der ZDF-Hitparade richtig in Fahrt kam, lässt Schmidt seinen Star R. in Blacky Fuchsbergers Auf los geht's los auftreten, von einem „Auftritt bei Heck“ ist auch einmal die Rede, und mit dem Rheingold-Sänger Bodo Staiger in der männlichen Hauptrolle wird ein realer Protagonist der Szene als Superstar im Zentrum deutscher Jugendkultur imaginiert. Während bei Heck dann eher die Industrieprodukte der zweiten Generation wie Markus oder Frl. Menke das Ruder übernahmen, ist Der Fan ein filmisches Zeugnis der frühen NDW, wie sie Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre vor allem aus den Punk-Epizentren Düsseldorf und Berlin hervorging. Alles findet sich wieder, die roboterhaften Auftritte R.s, der minimalistische Elektrosound, auch die Koketterie mit faschistischer Ästhetik, die bis zu R.s Logo mit zwei gezackten Blitzen reicht – dieses schwer decodierbare Spiel, mit dem Bands wie DAF damals Konservative wie Hippies gleichermaßen gegen sich aufbrachten. DAF ließen ihr Publikum in entgrenzter Ekstase „den Mussolini tanzen“ – Schmidt blendet von den rechten Arm hebenden Menschenmassen über auf ein warholesk aussehendes Porträt von R. Die Gleichsetzung von Star- und Führerkult ist umso irritierender, als sich beide Aufnahmen auf der Fototapete in Simones Zimmer befinden.
Isolation und parasoziale Interaktion

Die popkulturelle Zeitzeugniswerdung konnte die Kritik damals schwerlich voraussehen, der Score wurde vom Berliner Tip denn auch schlicht als „gräßliches elektronisches Musik-Geplärre“ abgewatscht. Aber auch davon abgesehen, ließ sie kaum ein gutes Haar an dem Film: Der Fan bleibe „jegliche filmische Gestaltung jenes soziologisch und psychologisch gewiß erklärungsbedürftigen Phänomens der Jugendkultur schuldig“, monierte etwa die Frankfurter Rundschau. Eine These, die sie kurioserweise mit der durchaus zutreffenden Beobachtung untermauern wollte, dass die „Umwelt dieses sich immer mehr isolierenden Mädchens: Familie, Schule, Freunde, […] leblose Kulisse und Statisterie“ bleibt – so als ob nicht gerade das die passende filmische Gestaltung für eine Umwelt wäre, in der sich alles Sehnen nur auf etwas außerhalb von ihr richten kann.

Denn in der Tat, Simone ist von Anbeginn ein Fremdkörper in ihrer Umwelt, von Eltern, Lehrern, Briefträgern verständnislos angeglotzt, und hat ihrerseits diese Umwelt längst als lästig und uninteressant aufgegeben – jeder Schuss-Gegenschuss ist hier ein Protokoll der Nicht-Verständigung. Meistens ist sie hinter ihrem Walkman-Kopfhörer verschanzt, mit R. verdrahtet, auf den ihr Dasein einzig fokussiert und der für sie unerreichbar ist. Während heute eine einzige Antwort auf Twitter oder Instagram ausreicht, um eine Illusion persönlicher Nähe zu erzeugen, war man als liebender Fan Anfang der 1980er Jahre noch ganz ins Feld der „parasozialen Interaktion“ verbannt. Simone küsst den Starschnitt in ihrem Zimmer, schreibt R. unablässig Briefe, ihre im Voice-over verkündeten Liebesgeständnisse enthalten kaum etwas Spezifisches über diese „Beziehung“ und betonen umso überzeugter, dass sie und sie allein diejenige ist, die R. glücklich machen kann. Desirée Nosbuschs in Hingabe gefangenes Gesicht, oft mit Tränen in den Augen, wurde als schlechtes Schauspiel bezeichnet – ebenso gut könnte man die in alten Beatles-Aufnahmen hin und wieder zu sehenden Mädchen, die wie erstarrt zwischen ihren ausrastenden Nachbarinnen sitzen und zu paralysiert sind, um zu kreischen, für unauthentisch halten.

Zwischentitel gliedern Simones Warten auf einen Antwortbrief in sieben Tage, sieben vergebliche Wege zur Post und den zunehmend genervten Beamten, siebenmal isoliertes Driften in immer weiteren Kreisen durch die Stadt, sie legt sich auf Rückbänke fremder Autos, läuft vor angehaltenen Autos weg, ab und zu, als Vorzeichen auf das Kommende, bricht ihr zierlicher Körper in jäher Aggression aus, wenn sie nicht bekommt, was sie will. Bei einem abgewehrten Vergewaltigungsversuch auf einem Rastplatz überrumpelt sie den Täter mit ihrer eruptiven Gegengewalt völlig – dieses Intermezzo, ein leicht ins Groteske gedrehter Aktenzeichen-XY-Anhalteralbtraum mit schmierigem Fahrer und Kampfhund auf dem Beifahrersitz, baut Schmidt ein, als Simone nach München trampt, um R. leibhaftig zu begegnen.
Auflehnung gegen die Vergänglichkeit

Und wirklich gelingt es ihr bei einer Autogrammstunde vorm TV-Studio – auf weitem Abstand zu den anderen Fans, als wäre sie keine von ihnen – R.s Aufmerksamkeit zu gewinnen, nach einem Ohnmachtsanfall wacht sie hinter den Kulissen wie in einem Traum auf, sein Gesicht über ihr. Und wird nun in seine Welt geführt, seiner Entourage vorgestellt, in seinem Rolls-Royce mitfahren, von ihm in eine verlassene Wohnung gebracht – ein New-Wave-meets-Antike-Refugium, abgeschottet von der Außenwelt –, schließlich mit ihm schlafen. Es gibt wenig Anzeichen, dass Simone jemals an sich lässt, was offensichtlich ist: dass sie für den emotionslosen Schnösel R. nicht mehr ist als nur ein weiteres Groupie. In ihrem grellen Aufschrei, als er nach dem Sex vor der Tür steht und gehen will, entlädt sich ihr Protest und ihre Angst, dass der so lang ersehnte Augenblick schon wieder vorbei ist; ihre Bluttat ist schlicht eine Auflehnung gegen die Vergänglichkeit.

Während die parasoziale Interaktion des Fans also zu einer realen wurde, blieb die Nähe doch eine Illusion, wurde die Schwelle zur Zweisamkeit nie überschritten. Ganz für sich hat Simone R. erst, als er tot ist, fast zehn entrückte Minuten lang zeigt der Film sie alleine mit der Leiche, die sie streichelt, liebkost, zerteilt, verspeist. Verstörender als der (eher harmlose) Gore-Gehalt oder die unübersehbare Freude an der ästhetischen Inszenierung – das kühle blaue Licht der Tiefkühltruhe, der im Topf angerichtete Fuß, die säuberlich aufgereihten Knochen – ist, wie in diesem kannibalischen Ritual tiefe Innigkeit und tiefe Einsamkeit eins sind und wie Simones Derangiertheit dabei langsam in etwas wie Zufriedenheit übergeht. Als sie am Ende wieder in ihrem Jugendzimmer sitzt, äußerlich in R. verwandelt (im gleichen Look, mit kahlem Schädel und braunem Hemd, stand er bei dem Münchner TV-Auftritt zwischen Schaufensterpuppen herum) und mit seinem Kind in sich, wirkt sie glücklich und mit sich im Reinen.

Kurz bevor Simone mit R. Sex hat, zoomt Schmidt auf ihren sich öffnenden Mund wie in einen schwarzen Schlund. Dem Film ist ihr Fantum ein Beispiel für die Urgewalt der einseitigen Liebe in ihrer buchstäblich verschlingendsten Form. Die Absolutheit dieser Liebe ist von Anbeginn gesetzt – gleich in der ersten Sequenz erklimmt Simone das Ulmer Münster und verkündet im Voice-over ihre Bereitschaft zum suizidalen Sprung, um R.s Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen –, an der Einseitigkeit ändert sich bis zum Ende nichts. So ist die melancholischste Einstellung, im Moment der größten Hingabe, ein Close-up auf Simones Hände, die eben noch R.s Kopf über sich hielten und nun wie erstarrt ins Leere greifen.
Neue Kritiken

Primate

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail
Trailer zu „Der Fan“

Trailer ansehen (1)
Bilder


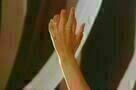

zur Galerie (17 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.












