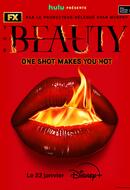Das Licht – Kritik
Tom Tykwer macht in Das Licht, was er kann. Und noch einiges mehr. Das Drehbuch hat er vorher offensichtlich niemandem zu lesen gegeben, der oder die ihn hätte stoppen können.

Ziemlich zu Beginn kommt Tim, Nachname Engels, nach Hause, klatschnass, reißt sich die Kleider vom Leib und zieht blank. Vermutlich weil er Lars Eidinger ist. Auf dem Boden der höhlenartigen Berlin-Charlottenburger Altbauwohnung liegt, hingestreckt von einem Herzinfarkt, wir waren dabei, die polnische Reinigungskraft. Tim, fussliger Bart, etwas zu langes Haar mit prononciert kahler Hinterkopfstelle, spaziert baumelnden Schwengels an ihr vorbei, und sieht sie sowas von nicht. So einer ist er: egozentrischer Partner, egozentrischer Vater, immer zu spät, nicht zuletzt zur Paartherapie, blind für die Mitwelt der Lebenden und auch der Toten.
Regie zieht blank

Ganz zu Beginn fliegt die Kamera (Christian Almesberger) in den Film. Vom Himmel über Berlin, aber auch sehr à la Psycho von Hitchcock, nähert sie sich einer Hochhauswohnung, Leipziger Straße, Nähe Fischerinsel, und dringt in einer gefaketen Plansequenz ein durch die geöffnete Balkontür. Mit diesem Schauwert zieht die Regie gleich mal blank und zeigt, was Tom Tykwer kann. Sie und er können dann noch ganz andere Sachen, aber erst einmal nähern sie sich einem seltsam pulsierenden Licht. Und mit diesem Licht einer Heilsbringerin namens Farrah (Tala Al-Deen), die im Lauf der nächsten 160 Minuten wirklich eine Menge ins Lot bringen muss.
Vor allem die Familie Engels, das sind, neben Tim (Lars): Milena (Nicolette Krebitz) und die siebzehnjährigen Zwillinge Jon (Julius Gause) und Frieda (Elke Biesendorfer). Sowie, er klingelt gleich an der Tür, Grundschulkind Dio (Elyas Eldrige), Produkt einer Kenia-Affäre Milenas, die die Beziehung nicht zum Scheitern gebracht, aber zu einem transkontinentalen Patchwork gemacht hat. In Kenia hat Milena auch in der Erzählgegenwart noch zu tun, sie ist Auftragnehmerin für Regierungsprojekte, in deren Rahmen sie kein Operndorf, aber ein Theater für Nairobi ins Werk setzen will. Auf dem Rückflug schwere Turbulenzen just im Moment, in dem in Charlottenburg die Reinigungskraft am Herzinfarkt stirbt. So hängt manches mit manchem zusammen, den esoterischen Gedanken hat sich Tykwer von der, aber auf ganz tolle Art, verschwiemelten Wachowski-Serie Sense8 mitgebracht, in der er ein oder zwei Finger drin hatte.
Magical Syrerin als Lichtgestalt-Mix

Engels-Sohn Jon lebt in einem Messie-Zimmer in seiner eigenen Gamer-VR-Brillen-Welt, “Transportal” ist der Name des Spiels, in dem er in die Champions League will. Tochter Frieda ist auf dem aktivistischen Trip, tanzt auf Acid durch die Nachtwelt und baumelt als warnende Leiche letzter Generation vom Autobahnring-Tunnel. Eine Abtreibung kriegen wir, anders als die eigene Mutter, ebenso mit wie die Vermutung, dass bei ihr eine Sex-Störung vorliegt. Die wird zuletzt in Richtung Lesbianismus begradigt. Ausgedachter Quatsch, wie alles andere auch, aber während sonst alle ziemliche Profi-Schauspieler sind, die noch die dümmsten Tykwer-Dialoge geradeaus aufgesagt kriegen, kommen sie aus Elke Biesendorfer oft ganz schön schräg raus, und nur so ist es richtig.
Mutter Milena erzählt der Paartherapeutin (Victoria von Trauttmansdorff) von der traumatischen Geburt ihrer Kinder. Not-Kaiserschnitt, Anästhesie ging daneben, halb war sie tot, hing nach Engel-Art unter der Decke und sah sich und alles schon von diesem Oben. Das tut Tykwer auch, immer schon, und hier ganz und gar. Durchaus buchstäblich, zack Kamera blickt wieder von oben auf die irdischen Sachen da unten, wie überhaupt die Mystik bei Tykwer grundsätzlich ausbuchstabiert werden muss. Aber eben auch figurativ: Familienaufstellung, vom Drehbuch so überdeutlich wie akkurat arrangiert, mit einer magical Syrerin als Lichtgestalt-Mix aus Erlösungs- und Reinigungskraft.
Erfolg ist eine gefährliche Sache

Tykwer tut, was er kann. Und noch einiges mehr. Weil es halt geht: die sinnlosesten Ausbrüche ins Musicalhafte, seit Jacques Audiard Mexiko unsicher machte. Mitten auf der Mommsenstraße Übergang in die Animation mit Superhelden-Appeal. Am Westhafen zieht ein magischer Wind auf und ab geht es schwerelos wieder nach Oben. Zwischendurch wird, weil die Taxis streiken, U-Bahn gefahren (verkehrte Welt, kann man da als Berliner nur sagen), dann aber geht es mit Frieda auf dem Fahrrad hinab in die dunkle Unterwelt unter dem Potsdamer Platz. Nicht zu vergessen: Von dem, was in diesem Film mit ihr angestellt wird, wird sich die Bohemian Rhapsody so schnell nicht erholen.
Zugegeben: Es ist auf eine perverse Art unterhaltsam, was Tykwer hier treibt. Erfolg ist eine gefährliche Sache: Niemand hat ihn beiseite genommen und ihm die Wahrheit über dieses Drehbuch gesagt. So spricht aus dem Ganzen ein horrender Größenwahn, es ist der für die fatale Selbstgerechtigkeit seines quasi-göttlichen Fuhrwerkens blinde Versuch, mit den Mitteln törichter und politisch desaströser Tropen die aus den Fugen gegangene Welt einzurenken. Berlin sieht darin aus, wie es in der stadtmarketingnahen Kinowerbung für miese Berliner Biere oder miese Berliner Banken auch aussieht. Mit magischem Realismus gepimpt. Und weiß Gott: Das macht es nicht besser.
Neue Kritiken

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho

Die Spalte
Trailer zu „Das Licht“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (7 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.