Crimes of the Future – Kritik
In der Fetischwelt von Crimes of the Future werden Körper seziert und Philosophien verwoben, geht Ekel in Genuss über. David Cronenbergs genussvoll laberlastiger Film ist mysteriös und überdeutlich zugleich.

Alles verrottet. Metall rostet, Putz bröckelt, Stein verwittert. Die Zukunft, die David Cronenbergs Crimes of the Future im Titel ankündigt, folgt einer regressiven, verschlungenen, ziellosen Zeitachse. Sie ist weder apokalyptisch noch utopisch. Sie ist eher die Verfallserscheinung unserer Gegenwart, aus ihr gewachsen wie ein Geschwür. Gleich das erste Bild zeigt das seitlings gekenterte, in der Brandung rostende Wrack eines Kreuzfahrtschiffs, das auf unheimliche Weise an die Costa Concordia erinnert: Die Zivilisation ist auf Grund gelaufen. Crimes of the Future wurde größtenteils im nächtlichen Athen gedreht und zeigt die von realen Krisen gebeutelte Metropole als Kaleidoskop der kapitalistischen Zukunft. Douglas Kochs Kamera suhlt sich in tiefdunklen Ocker- und Burgundtönen, an ins Leere laufenden Gassen, düsteren Gewölben, ruinösen Sälen; an Ansichten verfallener Hochkultur, an ihren Rissen, Schraffuren, Brüchen.
Eine Welt wie ein großer Darkroom

Was für Feststoffe gilt, gilt in Cronenbergs Vision noch mehr für das Fleisch. Die Evolution ist in ein Stadium des Wildwuchses eingetreten, entwickelt in Körpern wie dem von Saul Tenser (Viggo Mortensen) ständig neue, zwecklose Organe, mutiert ins Nirgendwo hinein. Tensers unaufhörlich metastasierendes Inneres drängt ständig nach außen: Er stöhnt, ächzt, rülpst, würgt, stößt auf. Mortensen spielt diesen siechenden Leib mit Gusto, balancierend auf der Grenze zwischen Body Horror und Physical Comedy. Es ist widerlich, ihm zuzuhören, und urkomisch, ihm zuzuschauen.

In der Welt von Crimes of the Future ist dieser Schmerzensmann erleuchtet, ein Medium. Denn fast alle anderen Figuren können – ob wiederum durch evolutionäre Prozesse oder Fortschritte in Technik und Medizin, bleibt unklar – keinen Schmerz mehr empfinden, keine Krankheiten bekommen. Was ihnen bleibt, ist der frei drehende Todestrieb, die perverse, unerfüllbare Suche nach dem Kick des Leidens, dem Blick ins Innere der geheimnisvollen Maschine Körper. Viele haben kleine Messerchen dabei, ritzen einander in dunklen Gassen die Waden auf, lecken Wunden, werfen dem wandernden Passanten verstohlen-wissende Blicke zu. Eine Welt wie ein großer Darkroom.
I wanna feel you from the inside

Saul hat mit seiner Partnerin Caprice (Léa Seydoux) aus seinem Leiden ein Businessmodell gemacht. Als Performance Artists führen sie für ein illustres Publikum Live-Operationen durch: Saul wird von einer organisch anmutenden, mit allerlei Skalpellen, Spangen und Klammern ausgestatteten Apparatur aufgeschlitzt, Caprice hält die Fernsteuerung. Seine neusten Organmutationen werden aus den Gedärmen geborgen wie heilige Grale und dem raunenden Publikum präsentiert. Das erinnert vage an eine groteske, fleischige, tiefdunkle SM-Version von Chris Cunninghams Musikvideo zu Björks „All Is Full Of Love“. Oder, eine andere in die Jahre gekommene popkulturelle Assoziation: an den aufgegeilten Industrial von Nine Inch Nails‘ „Closer“: „I wanna feel you from the inside….“. Die Suche nach der „inneren Schönheit“, wie sie Kunst und Philosophie von Anbeginn an begleitete, die Sehnsucht, sich zu öffnen, von innen zu zeigen, wird hier im wahrsten Sinne des Wortes durchexerziert. Aber das Rätsel ist unlösbar. Es bleibt die Dekadenz.

„Surgery is the new sex.” „Body is reality.” „An organism needs organization.” Cronenbergs Drehbuch strotzt nur so von kühnen posthumanistischen Slogans. Crimes of the Future ist ein genussvoll laberlastiger Film. Nahezu jeder Dialog ist eine Arte verquere kryptophilosophische Abhandlung. Jede Figur schwingt unablässig Thesen. Denn alle gehören irgendeiner Gruppierung an, haben eine kollektive Mission: Ob Beamten einer Behörde für noch unbekannte Organe, eine politische Terrorgruppe aus Biomechanik-Handwerkerinnen, die Mikroplastik-Esser mit ihren modifizierten Verdauungstrakten oder eine obskure Polizeieinheit, die eben jene jagt: Alle müssen einander und dem Publikum erstmal erklären, warum, weshalb, wozu.
Eine Satire, nur worüber?

Aber auf wundersame Weise verunklart das ständige Sagen von Ideen, was eigentlich gemeint ist. Als würde auch das Denken vergären und fermentieren, x-Mal Gehörtes in grotesken Knäueln wiederkäuen. Man kann den Film leicht als Satire verstehen, nur worüber? Techno-Utopien? Postapokalypse-Sehnsucht? Pornografie? Kunst? Beauty-Industrie? Fankultur? Alles ein bisschen. Das könnte schnell „boring and interesting at the same time“ werden, wie ein Kritiker einmal über Cronenbergs ebenfalls Crimes of the Future betitelten Zweitfilm von 1970 schrieb. Aber der Regisseur kultiviert diesen sicher negativ gemeinten Modus mittlerweile mit Hingabe – und schafft damit eine verwirrend anregende, matt anstachelnde Atmosphäre. Alles ist mysteriös überdeutlich.

Die Titelwiederholung ist dabei ein augenzwinkernder Hinweis, wie sich der neue Crimes zum mittlerweile mehr als vier Dekaden umfassenden Oeuvre Cronenbergs verhält: Motive, Themen, Sinnlichkeiten aus der Vergangenheit werden hier remixed, wieder aufgegriffen, variiert, voran- und zurückgetrieben. Giovanni Marchini Camia hat in einer schönen Kritik aufgelistet, welche Verweise sich zum Werk des Regisseurs finden lassen, von den Interface-Körperöffnungen eines Videodrome (1983) über die sexualisierten Verstümmlungen in Crash (1996) bis zu den anti-digitalen, funktional unklaren Biomaschinen in ExistenZ (1999, der hieß im Arbeitstitel übrigens ebenfalls mal Crimes of the Future). Auch die perversen Operationsbestecke und die Fetischisierung des Körperinneren aus Dead Ringers (1988) kommt einem in den Sinn.
Was ist pervers in einer Welt ohne Tabus?

Aber mehr als an alle anderen seiner Filme erinnert Crimes of the Future wohl an Cronenbergs mäandernde Borroughs-Adaption Naked Lunch (1991) mit seinem von eigenartigen Sekten bevölkerten und von undeutlichen Verschwörungsplots durchzogenen Tanger, mit einer zwischen Comedy, Horror, Film-Noir und postmoderner Dissertation pendelnden, richtungslosen Erzählbewegung. Beide Filme existieren jenseits von Genre und Erwartungen, beide fragen danach, was in einer Welt ohne Normen und ohne Tabus noch pervers sein kann, welche Affekte übrigbleiben, wenn Gefahr, Angst, Skrupel nichts mehr zählen. Und beide sind Genuss auf jene Art, die man im Englischen „acquired taste“ nennt: nicht für jede*n. Sie sind durchaus krass, aber ohne wirklich zu schocken, gemächlich im Tempo, aber fast schwindelerregend dicht. Halb Zigarren-Lounge, halb Fetischclub. Ein alter, schwerer Rotwein, in dem verborgen ein Meskalin-Wurm liegt.
Neue Kritiken

Ella McCay

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

No Other Choice

Ungeduld des Herzens
Trailer zu „Crimes of the Future“



Trailer ansehen (3)
Bilder
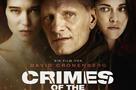



zur Galerie (12 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Hazel Caden
Der Film ist Absynth und Opium aus den 20er Jahren. Wunderbar und fernab jeglicher Erklärungsnotwendigkeiten. Dunkle Ästhetik ohne Sinn. Wunderbar


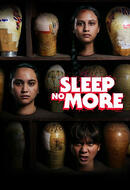
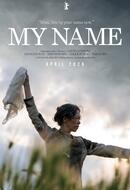

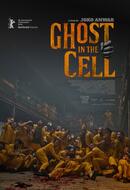














1 Kommentar