Blaubarts jüngste Frau – Kritik
Mit Blaubarts jüngste Frau hat Catherine Breillat eine Märchenverfilmung geschaffen, in der die Heldin nicht aus Zwang oder Liebe, sondern aus Lust an der Angst heiratet.

„Es ist so schön, es ist unglaublich, dass es jemandem gehört“, sagt Marie-Catherine (Lola Créton) ihrer Schwester Anne (Daphné Baïwir), als die Kutsche an einem Schloss vorbeifährt. Wer da zaghafte Ansätze einer Kritik an den Eigentumsverhältnissen heraushört, kommt gleich auf seine Kosten: Mit einer anachronistischen Schärfe bringt Anne im nächsten Moment die soziale Ungleichheit ihrer Zeit – die Handlung spielt im Mittelalter – zur Sprache. Es entbehrt nicht einer gewissen Komik, die beiden deklassierten Schwestern, die nach dem plötzlichen Tod des Vaters vom christlichen Privatinternat fliegen, so altklug und präzise über ihre Lage und die Gesellschaft sprechen zu hören. Es ist vor allem emblematisch für Breillats Aneignung des Märchens Blaubart: Wo das Original weibliche Neugier als gefährlich brandmarkt, stattet Breillat ihre Heldinnen mit der schärfsten Waffe aus: Wissen.
Die Lust an der Angst

Damit gelingt eine erste Distanzierung vom Originalstoff, noch innerhalb der Geschichte selbst: Die Protagonistin steuert nicht wie eine dumme Gans auf ein für sie unerwartetes Drama zu, sondern handelt, innerhalb der engen Grenzen ihres Standes, selbstbestimmt. So beschließt die jüngere Marie-Catherine, die nach materiellem Wohlstand strebt, das patriarchale System für sich zu nutzen und den allseits gefürchteten Ritter Blaubart (Dominique Thomas) zu heiraten, ehe der sie überhaupt mit seinem Reichtum bezirzen konnte. Doch neben dem Wunsch nach sozialem Aufstieg deutet sich ein anderes Motiv an: Marie-Catherine ist angezogen von Blaubarts Ambivalenz. Sie hat keine Angst, sie hat Lust; eine Lust, die nie explizit bebildert wird – schon gar nicht in sexuellen Handlungen, von denen der Film ganz frei ist –, die aber in einer Szene gipfelt, in der Marie-Catherine Blaubart hingebungsvoll den Hals hinhält, damit er das Todesurteil vollstrecken kann.

Die Lust an der Angst ist das zentrale Thema in Blaubarts jüngste Frau. Eingebettet ist die Abwandlung des Märchens in die Geschichte eines anderen Schwesternpaares, diesmal (vermutlich) im 20. Jahrhundert: Catherine, ein etwa fünfjähriges Mädchen (Marilou Lopes-Benites), liest seiner älteren Schwester Marie-Anne (Lola Giovannetti) das Märchen Blaubart vor. Marie-Anne hat Angst und Catherine genießt die Macht, die ihr die Erzählung über die ältere Schwester gibt. Genüsslich treibt sie das Märchen auf seinen allen Beteiligten bekannten, aber nicht minder gruseligen Höhepunkt zu.

So sind der Akt des Erzählens und die Erzählung selbst in Breillats Blaubarts jüngste Frau mehrfach ineinander verschränkt. Dabei ist die zweite Handlungsebene mehr als nur ein Rahmen: Sie gibt ein Echo auf die schwesterliche Beziehung im Märchen ab. Hüben wie drüben versucht ein Mädchen der älteren Schwester, der Rivalin, überlegen zu sein: indem es ihre Angst ausreizt, indem es vor ihr in den Frauenstand gehievt wird. Catherine und ihr Mittelalter-Ego Marie-Catherine sind die Unerschrockenen, oder eher: diejenigen, die mit ihrer Angst zu spielen wissen; sie zu modulieren verstehen, um eine Gruselgeschichte länger auszuhalten als die Schwester; sie in ein lustvolles Erlebnis umwandeln können.
Der Sieg über den Tod

Lustvoll ist auch die Inszenierung des zentralen Moments, in dem die verbotene Kammer betreten wird. Zum ersten Mal verflechten sich die Handlungsebenen: Nicht die mittelalterliche Marie-Catherine steckt den goldenen Schüssel in den Schloss, sondern Catherine. Doch auch ohne die jüngere Protagonistin treffen sich in der Inszenierung die Genres und die Epochen: am Boden die ungenierte Künstlichkeit einer gigantischen, flüssigen, neonroten Blutlache; an den Pfählen Frauen in makellosen weißen Gewändern, die an Schaufensterpuppen erinnern und so aussehen, als würden sie über dem Boden schweben, was der Szene einen magischen Charakter verleiht. Mit ihren leicht gespreizten Beinen und dem Blut evoziert der Anblick eine Geburt. Es ist, in vielerlei Hinsicht, eine zentrale Szene. Weil sie die weitere Handlung im Märchen bestimmt, weil Erzählung und Erzähltes verschmelzen, und weil hier die förmlich im Tod watende Catherine in ihrer widerständigen Lebendigkeit bestätigt wird: In einer tollen Aufnahme schlüpft sie zwischen die Beine eines der Opfer, als würde sie geboren.

Catherine/Marie-Catherine ist die Siegerin in diesem Film. Sie siegt über die christliche Institution, deren Heuchelei sie durchschaut und deren Bildersprache Breillat für ihre Zwecke vereinnahmt: Die letzte, gemäldehaft kadrierte Szene, in der sie zärtlich über das abgetrennte Haupt von Blaubart streicht, beschwört die erste Einstellung des Films, die ein religiöses Motiv zeigt. Sie siegt über das Patriarchat, enttarnt es in seiner Schwäche – Blaubart mit nacktem Oberkörper, blass, fett und weich, beinahe Mitleid erregend – und macht aus ihrer eigenen vermeintlichen Schwäche eine List. So entzieht sie sich Blaubarts sexuellem Zugriff, indem sie ein Schlafzimmer wählt, das so schmal ist, dass Blaubart es mit seiner Statur nicht betreten kann. Schließlich siegt sie über den Tod, weil sie ihn nicht fürchtet: Den toten Vater findet sie „noch schöner“, Blaubarts toten Frauen begegnet sie mit Neugier, und den enthaupteten Blaubart betrachtet sie noch zärtlicher als zu seinen Lebzeiten. Der Tod hat in Breillats Inszenierung etwas Irreales, dem Ende Trotzendes: Der tote Vater atmet ungeniert, Blaubarts Opfer verwesen nicht. Das Kindliche siegt: weil es dem Tod so fern ist, und weil der Tod ihm so fern ist.
Zur Einführung unserer Catherine-Breillat-Reihe geht es hier.
Neue Kritiken

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho

Die Spalte
Trailer zu „Blaubarts jüngste Frau“

Trailer ansehen (1)
Bilder
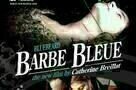



zur Galerie (10 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.















