Antiporno – Kritik
Harder, more, much more: Sion Sonos Antiporno zeigt Figuren bei einem Pornodreh in all ihrer Anstrengung und Sehnsucht, etwas zu bedeuten.

„People’s lives don’t have a theme“, raunzt Kyoko (Ami Tomite) der Interviewerin entgegen, als sie gefragt wird, von welchem Thema ihr neuer Roman denn handle. Bei ihr, da gehe es immer um das Leben, um das Echte und Wahre. Damit formuliert Kyoko als Protagonistin in Sion Sonos Antiporno ziemlich akkurat die Agenda des Filmes, der sich wie sie weigert, ein Thema zu formulieren oder eben im Nachhinein an eines binden zu lassen. Weil es um nichts weniger gehen soll als um das große Ganze, um das rohe, menschliche Leben in all seinen Facetten. Puh.
Worauf warten wir? Und finden wir jemals hier raus?

Wie selbstverständlich bewegt sich Künstlerin Kyoko durch ein Atelier mit knalligen gelben und roten Wänden, das zu steril ist, um ihre Privatwohnung zu sein, aber zu eingerichtet, um als fancy Ausstellungsraum durchzugehen. Wir beobachten, wie Kyoko in diesem Atelier tanzt, lacht, schreit, malt, weint, pinkelt, kotzt (manches auch in Kombination). Vor allem aber denkt sie über das Leben und ihre Rolle darin nach. „Nothing is going right. Not at all. Not one bit“, seufzt sie, „But it’s not my fault.“ Das weitläufige Atelier als Schauplatz von Antiporno wirkt klaustrophobisch und surreal. Es scheint für seine Protagonistin und ihre Gefühle zu klein zu sein, hält sie gefangen in einer Denkwelt, die um ihre Familie und den Tod der Schwester, die eigene Entjungferung oder auch gesellschaftliche Erwartungen an Frauen im Allgemeinen kreist. So werden inhaltlich konstant Einschließungsszenarien durchgespielt, die im Atelier ihre räumliche Entsprechung finden. Ein bisschen wie ein Kammerspiel, ein bisschen Sartre bis Beckett. Nur die Frage: Worauf warten wir eigentlich? Und finden wir jemals irgendwie hier raus?
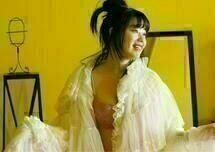
All diese existenzialistischen Krisen führt Regisseur Sion Sono insofern fort, als dass das filmische Geschehen von Antiporno selbst bei einem Filmdreh spielt. Genauer: Kyoko, die uns zunächst als Mannequin, dann als Schriftstellerin und Malerin vorgestellt wird, entpuppt sich als Darstellerin in einem Porno. Das Atelier verwandelt sich zum Erotikfilmstudio, in dem Kyoko gemeinsam mit Figuren wie „der Agentin“ oder „der Redakteurin“ routiniert vor der Kamera sexuelle Handlungen performt und manchmal bis zur Erschöpfung wiederholt. Sexualität tritt dabei als etwas auf, das im Sprechen miteinander eingefordert und autoritär organisiert werden will: „Kiss me“, „Fuck me“, „Lick me“, „Lick my legs“, „Get on all fours“, „On you knees“, „Walk like a dog“, „Give me your blood“. Zärtlichkeiten zwischen den Frauen gibt es weniger – oder eben nur, damit der nächste Befehl zur Bedürfnisbefriedigung umso nachdrücklicher wirken kann. Und immer wieder geht es bei den Machtspielchen und Erniedrigungsverhältnissen vor der Kamera um den Wunsch nach dem Mehr („More“, „Much more“), nach dem sich alle Figuren offenbar sehnen. Als ließe sich ein Mehr einfach einfordern vom Gegenüber und vom Leben, indem es laut herausgeschrien wird.
Ein Off existiert nicht

Dennoch stellt sich die Frage, inwieweit das hier gezeigte sexuelle, vor allem lesbische Begehren in jenem Film (im Film) ernst genommen wird. Oder ist es ausschließlich Projektionsfläche für männliche Fantasien? Wie lassen sich prinzipiell consent und Selbstbestimmung filmen? „Cut!“, ruft der Regisseur des Pornos irgendwann. Er verspricht damit eine Unterbrechung und ein Abseits der Szene, das es aber so nicht geben wird. Denn das Off in Antiporno, ein Ausgang, existiert nicht; an sich handelt es sich auch außerhalb der gefilmten Szene um ein ähnliches Setting. Vergleichbare gewaltvolle Aushandlungen von Macht und sexuelle Grenzüberschreitungen finden am gefilmten Porno-Set, bei dem Frauenkörper von den Männern hinter der Kamera angesehen, bewertet und gefilmt werden, statt. Sion Sonos Film zeigt Pornografie als massenindustriell gefertigtes Kunstprodukt, in das stets Blickdispositive und Geschlechterstrukturen eingeschrieben sind – so weit, so erwartbar.

Gleichzeitig will Antiporno, gemäß seinem Titel, genau kein Porno sein. Viel eher arbeitet sich der Film an einer Vorstellung von Pornografie ab und lässt sich als eine Meta-Reflexion des Genres beschreiben. Durch die Idee des Films im Film wird Kyokos Grundfrage danach verstärkt, was denn überhaupt real ist. Es lässt sich für sie nicht mehr differenzieren zwischen wirklicher und filmischer Welt, sodass Erinnerungen an ihre Schulzeit in die Aufnahmen vom Erotikdreh hineinschwappen. Im Atelier sitzt plötzlich ihre tote Schwester am Klavier. Und wer war eigentlich Kyoko selbst nochmal? Antiporno zeigt seine Protagonistin in der permanenten Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen wie filmischen/pornografischen Vor-Bildern; machtvollen Bildern, die unserem Denken vorgeschaltet sind, und die mal nützliche Orientierungshilfe, mal nur Verzweiflung im Streben nach ihnen bereithalten. „I’m pretty sure I’ll die“, sagt Kyoko irgendwann. Aber sie irrt sich: Im Film selbst wird sie nicht sterben. Der Film hält sie fest, fixiert sie, speichert sie ab. Das Kino: eine Unsterblichkeitsmaschine.
Neue Kritiken

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho

Die Spalte
Trailer zu „Antiporno“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (10 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.



















