Sombre – Kritik
„The body is everything. The story is nothing.“ Philippe Grandrieux’ Spielfilmdebüt lotet die Möglichkeiten des Films jenseits der Repräsentationslogik aus.

Sombre (1998), der erste Spielfilm des früheren Kunst- und Dokumentarfilmers Philippe Grandrieux, kann gewissermaßen als Mitbegründer der Ende der 1990er aufgekommenen neuen Welle des französischen Kinos gelten, die durch eine besonders exzessive Beschäftigung mit Körperlichkeit geprägt ist. Der Artforum-Kritiker James Quandt formulierte dafür leicht abwertend den Ausdruck „New French Extremity“. Der Filmwissenschaftler Tim Palmer, in seiner Haltung dem Phänomen gegenüber aufgeschlossener, entschied sich für den Begriff „The Cinema du corps“. Die Gemeinsamkeit der an sich sehr heterogenen Filme besteht im Effekt des Viszeralen, also in der physischen Attackierung des Zuschauers: Filmemacher, die eigentlich eher aus dem Arthousekino kommen, durchziehen ihre Arbeiten mit visuellen Codes aus dem Horror- und Splatterfilm und der Pornografie. Gaspar Noés Werk oder Catherine Breillats Filme seit Romance (1999) sind hierfür ebenso exemplarisch wie Patrice Chéreaus Intimacy (2001) und Marina de Vans In My Skin (2002).
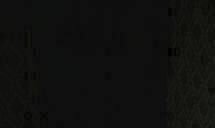
Bei Grandrieux sind es nicht der gnadenlos offene Umgang mit (meist emotionsloser) Sexualität oder die extrem harte Brutalität, die sein Spielfilmdebüt prägen. Zwar sind entsprechende Szenen auch in Sombre (auch bekannt als Dunkle Triebe) vorhanden, doch im Gegensatz zu den meisten anderen Filmen des neuen französischen Körperkinos, die jene Momente sehr explizit und ausführlich zeigen, erfolgt die Inszenierung des Sexuellen und der Gewalt eher beiläufig und lässt kaum etwas erkennen. Und das ist genau der Punkt, der das Extreme an Sombre ausmacht: der Umgang mit dem Filmkörper, also mit der Materialität des Mediums selbst, der die gewohnte Rezeptionshaltung des Zuschauers mehr als nur zu verunsichern vermag. Im Ansatz findet man diesen Aspekt auch bei vielen weiteren Vertretern dieser Welle, am deutlichsten wahrscheinlich in Noés Irreversible (2002) und Enter The Void (2009). Doch Sombre stellt sicherlich einen frühen Höhepunkt dieser Entwicklung dar. Grandrieux’ Credo „The body is everything. The story is nothing“ wird in diesem Werk äußerst konsequent umgesetzt.
Die Narration ist hier tatsächlich sehr marginal: Der Puppenspieler Jean (Marc Barbé) reist entlang der Tour-de-France-Route – wie zumindest die immer wieder eingeblendeten Bilder von Radfahrern und Zuschauergesichtern am Wegesrand suggerieren – und ist augenscheinlich vom Zwang zu töten besessen, den er an verschiedenen Prostituierten auslebt. Unterwegs schließen sich ihm die zunächst unwissenden Schwestern Claire (Elina Löwensohn) und Christine (Géraldine Voillat) an. Während Christine nach einem Angriff von Jean das Weite sucht, fühlt sich Claire auf merkwürdige Weise zu ihm hingezogen. Was sich hier als ein grobes Grundgerüst der Erzählung ausmachen lässt, ist über die Gesamtspielzeit von knapp zwei Stunden äußerst lose miteinander verbunden. Zwar versucht man unweigerlich, einzelne Sequenzen zueinander in Beziehung zu setzen, doch muss man daran immer wieder scheitern. So ist es zum Beispiel unmöglich, den Handlungsschauplatz zu rekonstruieren. Manchmal wird unerwartet durch harte Schnitte von einem Setting zum nächsten gesprungen, manchmal verwischt sich das Bild bis zur Unkenntlichkeit und löst sich unmerklich in einer Folgesequenz auf.

Auch die Figuren, vor allem Jean und Claire, deren kontinuierliches Auftauchen einen hermeneutischen Anschlusspunkt zu bieten scheint, lassen einen ins Leere laufen. Wenn Jean im Bild ist, ist die Kamera dicht – meist sogar zu dicht - an ihm dran, sein Kopf füllt nicht selten beinahe den kompletten Kader aus. Doch dieser Distanzverlust erzeugt keine Nähe zur Figur, zumal es meistens Jeans Hinterkopf ist, den man zu sehen bekommt. Die Zentralisierung von Jean lässt sich nur schlecht im Sinne eines psychologischen Porträts eines gestörten Serienkillers lesen. Generell scheint ein „Lesen der Bilder“ als Rezeptionsprozess bei Sombre nur sehr beschränkt vorgesehen zu sein. Der Film entfaltet sich kaum mehr als repräsentationales Zeichensystem, das eine das Medium selbst transzendierende Geschichte zu entwerfen versucht. Stattdessen möchte Grandrieux den Betrachter mit reinen, vorsymbolischen Filmbildern konfrontieren, die ihn vor und jenseits geistiger Dekodierung bereits beanspruchen.

So scheint es sich bei Jean und auch bei den anderen Figuren, deren Verhalten in vielen Momenten kaum psychologisch nachvollziehbar ist, um Nicht-Subjekte zu handeln, deren Existenz weniger als eine Abbildung von etwas zu verstehen ist denn als eine Herausbildung der filmischen Materialität. Am deutlichsten wird das in jenen immer wiederkehrenden Szenen, in denen sich Jean oder Claire unmittelbar aus einem schwarzen Nichts hervorschälen oder sich wieder darin auflösen. Und wenn Jean mit seinen Opfern ringt, lassen die Bewegungen, die zwischen bizarrer Zärtlichkeit und Gewalttätigkeit oszillieren, die Konturen der einzelnen Figuren untereinander wie auch mit dem dunklen Hintergrund verschmelzen. Generell ist es das Schwarzbild, das Sombre dominiert und auf die Opazität des Mediums verweist. Neben den vielen Momenten, in denen sich die Leinwand (beinahe) komplett verdunkelt, zeugen davon selbst die Szenen, die bei einem Tageslicht spielen, das stets unnatürlich trüb wiedergegeben wird.
Entsprechend Grandrieux’ Absage an die Narration werden all die Momente, die gängige Erzählkonventionen stören, regelrecht zelebriert. Neben der Dunkelheit ist es vor allem die Unschärfe, die hier zu einem spezifisch ästhetischen Ausdruck des Filmbildes erhoben wird. Damit gehen nicht selten Flickerlichteffekte und ein permanent wiederkehrendes Verwischen und Zittern als unterschiedliche Aggregatszustände des Filmbildes einher. Der Einfluss des amerikanischen Experimentalfilmers Stan Brakhage auf Grandrieux ist hier sehr deutlich zu erkennen. Besonders beeindruckend ist eine Szene, in der während einer Autofahrt die Aufnahmen von Einzelheiten der vorbeiziehenden Landschaften, Steine am Boden, Gräser und Getreideähren mit Jeans Haaren zu einem stellenweise völlig reinen Bildrauschen amalgamieren. An einer anderen Stelle, ebenfalls während einer Autofahrt, verschärft sich das Zittern zu einem so starken Wackeln des Filmbildes, dass man fürchtet, es würde gleich reißen.

Obwohl oder vielleicht auch gerade weil man als Betrachter den konkreten Bildinhalt oft mehr erahnen als erkennen kann, sieht man sich einer unangenehmen, fast schon einer Art Gewalt-Erfahrung ausgesetzt. Einen entscheidenden Beitrag leistet hierzu die Tonebene. Sparsam wird (meist innerdiegetische) Musik eingesetzt, im Wesentlichen pulsierende elektroide Tracks von Alan Vega und Bauhaus. Aber auch ansonsten ist der Film keineswegs still. Im Gegenteil, einerseits ist er oft unterlegt von einem sonoren Brummen, andererseits rauscht, knackst und knistert es beständig, wobei die Tonquelle oft entweder gar nicht identifizierbar ist oder die Geräusche eine Intensität mit sich bringen, die nicht allein aus der erkennbaren Quelle generiert werden kann.
Eine sehr eindrückliche Irritation wird gleich in einer der ersten Szenen erzeugt. Auf eine sehr ruhige Exposition folgt ein harter Schnitt zu einer kreischenden Schar Kinder, von denen die Kamera wie so oft nur das Antlitz erfasst. Ekstatisch verfolgen sie ein Schauspiel, das dem Zuschauer verborgen bleibt. Langsam wird das grelle Schreien von einen verhaltenen, aber bedeutungsschwangerem Soundtrack überlagert. Aber anstatt die Wichtigkeit dieser Szene für eine Gesamterzählung hervorzuheben, scheint der Sound eher eine Artikulation des Films selbst zu sein.

In Deutschland wurde Sombre wie auch die weiteren Filme von Grandieux kaum wahrgenommen. Eine DVD- oder Kinoauswertung gibt es bisher nicht. Lediglich auf Arte gab es bisher die Möglichkeit, Grandrieux’ visuellen Höllentrip zu „erfahren“, wie es bei dieser Art Film wohl passender formuliert ist. Denn mit seinem höchst eigensinnigen Hybrid aus Spiel- und Experimentalfilm hat der Regisseur ein Paradebeispiel dafür geschaffen, wie eine ergiebige Reflexion über das Medium Film jenseits des Repräsentationsprinzips nicht nur vor Augen geführt, sondern auch spürbar gemacht werden kann.
Neue Kritiken

Gavagai

Stille Beobachter

Im Rosengarten

Die endlose Nacht
Trailer zu „Sombre“

Trailer ansehen (1)
Bilder
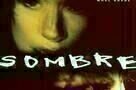



zur Galerie (11 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
c.
an sich kein schlechter text, der einen interessanten blick auf einen nicht ganz einfachen film ermöglicht. allerdings habe ich die (pseudo-)akademische wortwahl von "viszeral" über "opazität" bis "amalgieren" als unnötig prätentiös und störend empfunden.
Frédéric
Einzelne Begriffe stören mich nicht, aber was Fremdwörter angeht, bin ich sicherlich kulturell anders geprägt. Ich selber versuche durchaus beim Schreiben, "Übersetzungen" und Annhäherungen für die Begriffe zu suchen, die mir als Fremdwörter einfallen, aber will das nicht von anderen verlangen. Übrigens löst bei mir der Vorwurf des "Prätentiösen" Unverständnis (und auch Aggressionen) aus. Ist das ein Modewort geworden, für die Kritik an Erscheinungen, die einem fremd sind? In Diskussionen ist mir das jedenfalls in letzter Zeit oft untergekommen, es ist aber ein Punkt, an dem selten weiter geredet wird, es ist ein trennendes Wort, die Diskurs-Sphären sind damit aufgespaltet, auf beiden Seiten die Kommunikation beendet. Ich sehe für mich zwei Möglichkeiten: Es als Kommunikations-Ende hinnehmen oder das Wort umdeuten und das Prätentiöse reclaimen, für mich beanspruchen. Ich hadere noch.
Dunja
Eine Verzehr-Kritik: Ich verzehre mich nach diesem Film. Wie, wo kann ich ihn sehen? Eben. Aber: Soeben in Marseille Grandrieux' neuesten Film gesehen, WHITE EPILEPSY. Opak und viszeral, ganz genau. Demnächst zu sehen bei UNDERDOX in München.
c.
@frederic: einzelne begriffe stören mich auch nicht unbedingt, es ist eher die textur, die sie in diesem text erzeugen und die ich nicht überzeugend und zwingend finde. ausdrücke wie "effekt des viszeralen" bedürfen meiner meinung nach, dass man näher auf sie eingeht. komplexe gedanken sollten manchmal komplex ausgeführt werden statt nur auf sie anzuspielen.
deine reaktion auf den vorwurf des prätentiösen kann ich durchaus nachvollziehen und vermutlich ist es ein modewort, aber dennoch ermöglicht er mir hier auszudrücken, was mich stört. und das ist nicht die fremdheit an erscheinungen an sich, sondern dass ich die beschaffenheit der fremdheit ästhetisch nicht nachvollziehen kann oder überzeugend finde. mit dem trennenden wort "prätentiös" will ich also etwas bezeichnen, dass auf mich schon eine trennende wirkung hat, von daher ein durchaus passender begriff.
Frédéric
Schön gesagt. Mir erschließt sich in dem Fall das Viszerale schon allein über den Klang des Wortes, aber inwiefern sich das auf andere überträgt, was mir die Muttermilch mitgegeben hat ...
Ich verstehe diesen Gebrauch von "prätentiös" schon, glaube aber, dass ich grundsätzlich dann doch oft auf der Seite derjenigen lande, die "prätentiös" wirken, weil sie etwas ausprobieren. Übrigens würde ich den akademischen Begriff "hermetisch" vorziehen, weil da keine Absichtsunterstellung mitschwingt. Die Trennung wird irgendwo in der Mitte vollzogen, ob es der Autor oder der Leser ist, bei dem sie ansetzt, bleibt offen.
c.
@frederic: ok. ich wollte mit dem vorwurf des prätentiösen auch dem autor nichts unterstellen, sondern lediglich die wirkung des textes auf mich beschreiben. hermetisch ist vielleicht der besserer begriff, allerdings verfasse ich meine kommentare hier nicht als akademiker, sondern relativ spontan (was nicht unüberlegt heißen soll). ich weiß, was viszeral bedeutet, aber was mit "effekt des viszeralen" hier gemeint ist, bleibt für mich vage. (eine anspielung auf die james-lange-theorie?)
hermetisches kann auch esoterisch wirken, wie in dieser kritik, wo begriffe aus der wissenschaft unwissenschaftlich verwendet werden und mit neologismen wie "elektroid" und "amalgieren" (oder war "amalgalmieren" gemeint?) vermischt werden. das geht für mich hier auf kosten der vermittelnden funktion, die filmkritik meiner meinung nach auch übernehmen kann. und dem vorwurf der prätentiösität kann man auch anders begegnen, als die kommunikation einzustellen oder ihn zu "reclaimen", nämlich reflektieren, was damit jetzt genau gemeint ist und vielleicht eigene sichtweisen überdenken.
Frédéric
Ich bin auf die Frage nach dem bösen P.-Wort eingegangen, weil es mich jüngst mehrfach beschäftigte. Davon abgesehen finde ich Deine Kritik nachvollziehbar und adäquat. Es ist im Übrigen eine Diskussion, die wir intern des Öfteren führen. Schade natürlich, wenn die Vermittlung teilweise nicht ankommt. Dass es darum bei Kritik immer auch geht, ist mir ebenfalls wichtig. Prinzipiell mag ich aber die Verquickung von wissenschaftlichen Einflüssen mit nicht-wissenschaftlichem Gestus.
Michael
@ Dunja. Wie beschrieben, den Film gibt’s hierzulande normalerweise nicht zu sehen. Man muss ihn sich wohl irgendwo übers Internet bestellen.
@c. Danke für die Anmerkungen. Sie sind sicherlich nicht unberechtigt. Aber gerade „viszeral“ halte ich für ein wunderbares Wort. Es ermöglicht, etwas auszudrücken, das sich ja gerade auf den Bereich des nur schwer Artikulierbaren, Präverbalen bezieht. Bei einer Filmbesprechung wird es eingesetzt, um jene Momente / Bilder eines Films zu benennen, die jenseits der Repräsentationsfunktion oder zumindest darüber hinaus (wie ja weiter unten im Text anhand vom Sombre beschrieben) einen unmittelbaren Effekt auf den Zuschauer haben, der nicht im Bereich des kognitiven Verstehens, sondern eher des körperlichen Erfassens verortet wird (als Bezug hatte ich weniger die J-L-Theorie im Sinn, eher Steven Shaviro, Grandrieux selbst denkt wiederum mehr an Spinoza). Das Schöne an „viszeral“ ist nun, dass es, wie ich finde, ein sehr intuitives Wort ist, das sich, wie Frédéric richtig bemerkt hat, allein schon über den Klang vermittelt, und das viel besser, als es jede weitere Umschreibung tun könnte. Allerdings, es steht ja dennoch nicht völlig losgelöst im Text, wer nichts damit anfangen kann, kriegt im daran anschließenden Folgesatz (physische Attackierung) die Richtung vermittelt, in die es zeigt. Bei „amalgieren“ hast du freilich recht. Allerdings nicht „amalgalmieren“, sondern „amalgamieren“ sollte da lieber stehen (wurde nun ausgetauscht), was noch nichts am eigentlichen Kritikpunkt ändert. Natürlich hätte ich ein zugänglicheres Wort wie vereinigen oder verschmelzen verwenden können. Doch das trifft es für mich eben noch nicht genau so. Ich wollte mit diesem - wieder intuitiv verwendeten Wort - das „Darüberhinaus“ der Szene zum Ausdruck bringen, das sich hier jenseits des verbal Beschreibaren erfahren lässt. Generell finde ich es gerade bei einem Text zu einem Film wie Sombre durchaus auch zulässig intuitive und assoziativere (in diesem speziellen Fall vielleicht sogar teils auch „unscharfe“) Ausdrücke zu verwenden, wenn nicht sogar angebracht, da sie dem Wesen des Films doch näher stehen als eher eindeutig verständliches Vokabular.
c.
@Michael: wie gesagt, ich finde den text alles andere als schlecht und deine hier dargestellten absichten und erläuterungen finde ich durchaus nachvollziehbar. eine frage bleibt für mich aber: ist es hier sinnvoll das von dir ausgemachte wesen des films anhand deines textes ästhetisch nachzubilden? der film ist ja ein fordernder und leider auch einer der nicht viel presse und aufmerksamkeit bekommt. filmkritik kann hier zwischen einem potenziellen publikum und dem film vermitteln, oder? durch intuition und assoziation erreicht der text für mich fast schon zuviel von dem von dir so genannten "Darüberhinaus" - und schwebt zu hoch über den köpfen (und bäuchen) mancher leser.
c.
@Michael: P.S. bezüglich viszeral: ich verstehe schon, was es bedeutet. seine klangliche qualität will ich jetzt einmal außen vor lassen, aber ich finde es ist fast schon ein klischee etwas als viszeral zu bezeichnen. speziell in englischsprachigen kritiken ist das ja nicht selten, wobei ich geneigt bin zu behaupten, dass das englische "visceral" umgangssprachlicher ist als das deutsche gegenstück "viszeral".
Michael
Hm, die verbleibende Frage lässt sich wohl am besten mit einem entschiedenen Ja und Nein beantworten. Klar beantworten kann man sie wohl so ebenso wenig, wie man die Leserschaft pauschalisieren kann. Natürlich sollte man versuchen, den Graben zu schließen, den ein entsprechend forderndes Werk zwischen sich und den Rezipienten bildet. Allerdings werden sich vor allem solche Zuschauer und Leser für so einen Film bzw. Text interessieren, die auch bereit sind den Graben von ihrer Seite zumindest teilweise zu überqueren. Insofern kann eine an das Werk angelehnte Ausdrucksweise vielleicht gerade auch eine Vermittlungsfunktion übernehmen. Hierbei macht es für den Leser wahrscheinlich einen Unterschied, ob man den Film schon gesehen hat, also schon einen Eindruck hat. Ferner ist eine Filmkritik ist ja zum Teil ebenso eine subjektive Angelegenheit. Wenn bestimmte, nicht allgemein sofort verständliche Wörter einem helfen, nichts desto trotz das auszudrücken, was man als am besten zutreffend empfindet, kann man sie schon verwenden, denke ich. Ähnlich wie das in der Alltagskommunikation wahrscheinlich ebenfalls eher Fragezeichen hinterlassende Wort "prätentiös" es anscheinend ermöglicht, auszudrücken, was einen an einem Text stören kann. Gerade in einem vom Umfang her recht beschränkten Text können Fremdwörter oder Fachbegriffe auch als hilfreiche Shortcuts fungieren, wenn sie komplexere Zusammenhänge auf einen Begriff bringen. Und selbst wenn einzelne Ausdrücke etwas abgehoben wirken, muss das nicht unbedingt heißen, dass deswegen gleich der komplette Text zum Schweben gebracht wird.
annick lemonnier
Quel dommage que je ne comprenne pas la langue allemande ! Il semble très intéressant !
Best from Paris
annick



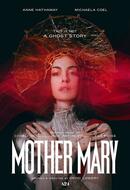














12 Kommentare