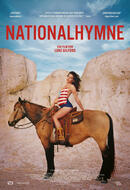Mein Ein, Mein Alles – Kritik
Die unmögliche Erdung intensiven Erlebens. Maïwenns neuer Film prescht unaufhörlich nach vorn und sucht nach Beruhigung.

Der cinemascopische Rahmen als beruhigende Horizontale. Alles springt herum und schreit darin, sprengt den Raum, strebt weiter nach vorn und kommt kaum zum Halten. Wir genießen das, die gewitzten Dialoge, die ungebundene Energie, und doch nur, weil es da diesen Rahmen gibt, der die Sprengung des Raumes, das Vorpreschen der Zeit, gerade noch so im Zaume hält, auf dass sie uns nicht vollständig besiegt und ermüdet. In einer Szene wünscht sich auch Tony (Emmanuelle Bercot) mit Tränen in den Augen eine Horizontale ins Leben. Georgio (Vincent Cassel), ihr „König“, kann das fast nicht glauben, er lässt seinen Zeigefinger im Zickzack auf und ab schnellen. Hoch und runter, Herzschlag, das ist das doch Leben; die gerade Linie, das wissen wir doch alle, ist der Tod. Tony schüttelt nur weinend den Kopf. Sie braucht den Rahmen, sie wünscht sich ihr Leben als Kino, nicht derart rahmenlos, mit so vielen Sprüngen und ohne Hoffnung auf Landung. Ihre Schmerzen haben sie gelehrt, was der Hobby-Kardiologe nicht sehen will: dass die Ausschläge des EKGs nur Leben bedeuten, wenn sie sich an einer Mitte orientieren – und dass Tony diese Mitte braucht, während Georgio sie nicht nötig zu haben glaubt.
Den Berg hinunter
Dass Regisseurin Maïwenn nicht hinterm Berg hält mit dem, was sie in Mein Ein, Mein Alles (Mon roi) vorhat, das kommt dem Film nicht in die Quere, weil der seine Affekte nicht im einzelnen Moment, in der einzelnen funktionalen Szene sucht, sondern in seiner Bewegung nach vorn, durch all diese Momente hindurch. Der Film stürzt sich den Berg hinunter, so wie Tony in der ersten Szene: Skibrille auf und ab dafür, an ihrem König und ihrem Sohn vorbei, endlich einmal schneller sein, aus dem Bild verschwinden. Das gelingt zwar, aber weil ihr Leben eben kein Kino ist, ist das Knie danach trotzdem im Eimer. Die folgende Schwarzblende ist nicht nur Anfang des Films, sondern auch das Ende einer zerstörerischen emotionalen Talfahrt, die wir fortan rückblickend von ihrem Anfangspunkt an erzählt bekommen, wobei sich der Epilog im Reha-Zentrum immer wieder fragmentarisch dazwischenschiebt.
Es ist nun nicht so, dass Tony nicht gewarnt worden wäre. Sie hat genug von den Arschlöchern, den conards, sagt sie Georgio mitten im frisch verliebten Techtelmechtel, nur halb im Spaß antwortet der, er sei der König der conards. Des Königs Gemächer beherbergen unter anderem eine Tropen-Fototapete und einen Kickertisch, kein gutes Omen, wie Tonys Bruder (Louis Garrel) sofort bemerkt. Restaurantbesitzer Georgio ist ein Poser, jemand, der für jede Situation den entsprechenden Spruch hat, sich nimmt, was er will, stetig neue Kicks sucht, der aber auch ungeheuer charmant und originell ist, so herrlich crazy – und zu Tonys ungläubigem Entzücken jetzt auch noch crazy in love.
Figurenzeichenstile
Nach Poliezei (2011) beweist Maïwenn erneut nicht nur ihr Talent für Schauspielerführung, sondern auch ihr Gespür dafür, dass Figurenzeichnung keine simple positive Größe ist, sondern vieles bedeuten kann. Dass es nicht nur um eine stärkere oder schwächere Zeichnung geht, sondern auch um den Zeichenstil. Hatte sie in ihrem letzten Film um eine Jugendschutz-Einheit bei der Pariser Polizei ein gesellschaftliches Thema mit Intimem angereichert, um es seiner üblichen filmischen Logik zu entreißen, entzieht sie ihren Figuren in Mein Ein, Mein Alles, wo es ja ohnehin um Intimität geht, das allzu Konkrete. Zwar glauben wir, Tony und Georgio immer besser kennenzulernen, zwar sind wir in jedem Moment bei ihnen, doch sind sie beide zugleich Prinzipien. Georgio fasst dieser Film als die reine Fassade. Noch den scheinbar gefühligsten Moment scheint er gekonnt zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen; alles nur heiße Luft, sagt Tony einmal. Tony dagegen ist die reine Innerlichkeit. Sie bringt die Geschichte in Gang, erkennt Georgio in einem Club wieder und bespritzt ihn mit Wasser, aber dann stößt ihr alles nur noch zu: das Verlieben, die Beziehung, das Kind, der Streit, das Drama. Er handelt, sie fühlt. Letztlich sind sie beide schwarze Löcher. Die ständig handelnde Fassade und die vollkommen authentische Passivität, zwischen diesen Extremen spielt Subjektivität sich ab. Mit dem einen lachen, mit der anderen weinen wir.
Genieße den Augenblick – mit Xanax

Und diese Prinzipien sind nicht schlicht als männliches Ungebundenheits- und weibliches Sicherheitsbegehren codiert. Vielmehr weiß dieser Film sehr genau, dass die Grenzen in unserer Intimitätskultur inzwischen ganz anders verlaufen. Georgio will nicht einfach nur Spaß, Affären und das Leben genießen, Anwältin Tony schwebt nicht bloß die Vater-Mutter-Kind-Zukunft vor, sie genießt ja gerade Georgios spontane Verrücktheiten. Das konservative Familienideal ist längst eingetauscht gegen das nicht minder wirkmächtige des intensiven Erlebens. Und hier – im Begehren nach dem besonderen Moment, nach dem Verrückten im Gewöhnlichen, nach den exzessiven Ausschlägen auf dem Lebens-EKG – ist Georgio tatsächlich ein König. Eines Nachts überrascht ihn Tony beim Bügeln, und er will – ganz verrückt – auf einmal ein Kind von ihr; die Hochzeitsfeier ist an extravaganter Spontanität nicht mehr zu überbieten, lockeres Picknick statt verkrampftem Dinner. Auch Ehe und Kinder versprechen ziemlich intensive Momente, vor allem wenn man zur Not eine Zweitwohnung hat. Die Tragik von Mein Ein, Mein Alles ist also weniger die Unvereinbarkeit zweier unterschiedlicher Vorstellungen vom Leben als die immanente Widersprüchlichkeit dieser beiden Vorstellungen: Tony will einen Mann fürs Leben, der sie vor allem zum Lachen bringen soll. Georgio will das verrückte Leben, zu dem aber bitte auch Sohn und lockere Ehe gehören sollen. Beide haben übrigens einen Stamm-Apotheker, der sie mit Anti-Depressiva versorgt.
Anti-identitäre Cabriofahrt
Auch der Film unterwirft sich diesem Diktum des intensiven Moments, aber im cinemascopischen Rahmen hat er eben schon jene Horizontale, die Tony so verzweifelt sucht. Doch auch sie wird fündig, weil Mein Ein, Mein Alles seine Doppelstruktur, mit der er sich von zwei Seiten demselben Drama nähert, hintertreibt und auch die dem kontemplativen Zurückblicken zugedachte Seite nach vorne preschen lässt; das Leben geht weiter, ganz unpathetisch, das Knie wird heilen. Im Reha-Zentrum lernt Tony ein paar Jungs kennen, die mal eben aus einem Banlieue-Sozialdrama vorbeizuschauen scheinen und die bald ihr neuer sozialer Fixpunkt werden. Gemeinsam spricht man über Typen, über Weiber, über die Haare von Arabern und die Haut von Weißen; man wird das alles mal sagen dürfen, weil hier keine identitäre Gemeinschaft am Werk ist, die sich damit selbst bestätigt; weil diese Leute nichts verbindet außer ein paar Bänderrissen. Die Reha als Heterotopie, als Ort, an dem sich Subjektivität im emphatischen Sinne erst ausbilden könnte. Wenn Tony und die Jungs zu lauter Popmusik eine Runde im Cabrio drehen, dann ist das ein fast schon absurd affirmatives Bild, aber es ist nur konsequent, dass Maïwenn uns hier schließlich doch mal eine Totale schenkt, denn irgendwie gehört es eingerahmt.
Neue Kritiken

Monster: Die Geschichte von Ed Gein

Dracula - Die Auferstehung

Frankenstein

Danke für nichts
Trailer zu „Mein Ein, Mein Alles“



Trailer ansehen (3)
Bilder



zur Galerie (3 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.