Ganz Junge Kritik in Cannes - Ordinary People
Wenn das Töten normal wird

Ein Bus voller Leute. Wer sind sie? Soldaten. Eine Sommerwiese. Hier könnte man gut picknicken. Oder hinrichten. Wodka. Zum Feiern? Nein, zum Vergessen. Ein großer Junge mit schmalen Schultern. Er ist so still, so nachdenklich. Hat er Liebeskummer, Probleme in der Schule? Nein, er hat getötet.
Im Film „Ordinary People“ von Vladimir Perisic erlebt der Zuschauer einen Tag im Leben eines Soldaten. Für den Neuling Dzoni ist es das erste Mal, der schlimmste Tag, der alles verändern wird. Vorher war er ein ganz normaler Junge, doch seit fünf Tagen wird gekämpft. Der junge Serbe lernt zu töten, der Zuschauer muss damit zurechtkommen, eine Gratwanderung von Normalität zu routinierter Perversion und Inhumanität mitzuerleben. Krieg wird hier ganz anders abgebildet, als man es gewohnt ist: Keine Schlachtfelder, keine Truppen, sondern ein stillgelegter Bauernhof an einem drückenden Sommertag ist Schauplatz für die Gruppenhinrichtungen. So ist Krieg wirklich, denkt der Zuschauer, der Krieg ist leise, das Töten geht schnell. Zwischendurch rauchen die Soldaten, Dzoni sogar mit einem der Opfer zusammen. Die Gründe des Tötens bleiben offen, Politik ist nach Perisic auch nicht Thema seines Films. Dzoni ist zufällig hier gelandet, er trägt Waffe und Uniform. Die Männer, die aus den LKWs geschubst werden, tragen Jeans und T-Shirts, sie sind alt und jung, sie sind angeblich Terroristen. In Wirklichkeit sind sie jedoch alle gewöhnliche Männer, ihre Rollen in den Hinrichtungen sind austauschbar.
Perisic verzichtet auf Musik und Nahaufnahmen, die Darstellung ist simpel, so wie die Aufgabe der Soldaten. Die Kamera bleibt von ihren Subjekten distanziert, viele Szenen sind in Echtzeit, der Zuschauer erlebt sie mit, als stünde er dabei, seien es die langen Wartezeiten oder die schnellen Tötungen. Besonders eindringlich sind die schockierenden Kontraste zwischen banaler Normalität und inhumaner Gewalt. Die Gefühle und Gedanken der Figuren werden nicht dramatisiert oder gedeutet, sondern müssen bei diesem Film in besonderem Maße vom Bewusstsein des Zuschauers ergänzt werden. So wird der Film zu einem persönlichen Erlebnis, das den Betrachter zwar verunsichert, ihn aber lehrt, sich selbst und die Abgründe des Menschen besser zu verstehen. Auch eine Erklärung der Motive sowie das Urteil über die Schuld bleiben dem Zuschauer überlassen, den „Ordinary People“ noch lange beschäftigen wird.
Kritik von Nora Heidorn (John F. Kennedy Schule, Berlin)
Sonnen, Rauchen, Saufen und ein bisschen Töten
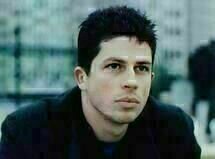
Symmetrisch gefaltet hängt die Bettdecke über der Pritsche, die Hände steif am Oberschenkel, der Blick starr nach vorn gerichtet. Zimmerinspektion in irgendeiner Kaserne, irgendwo. Alle tragen Uniformen, alle wirken gleich: teilnahmslose Gesichter. Ein Bus fährt vor. Die dritte Division verlässt das Militärgelände.
„Wohin fahren wir?“ Keiner scheint sich für die Frage des Neuen, Dzoni, zu interessieren. Hier herrscht Gleichgültigkeit und Ordnung. Obwohl er aussieht wie alle anderen, scheint er nicht hineinzupassen. Sie sollen Menschen töten, ohne Widerrede. Der Schein der grünen Natur und der warmen Sommersonne trügt. Durch die idyllische Stille dringen Schüsse. Die Kontraste sind in Vladimir Perisics Film beinahe unerträglich. So wechseln sich barbarische Hinrichtungen und banale Unterhaltungen bei einer Zigarette ganz selbstverständlich ab. Es sind eben nur „Ordinary people“. Gewöhnlich, austauschbar. Ein anderer Militärbus mit Soldaten fährt wie ein Spiegelbild vorbei. Es sind Figuren ohne Gesichter. Der Film gibt keine Antworten auf die Frage, warum diese Menschen das alles tun. Vielleicht gibt es auch einfach keine Antwort. Dinge passieren einfach, wie aneinander gereihte Fakten, zu denen die Kamera Distanz wahrt. Nahaufnahmen gibt es kaum. Die Bildgestaltung folgt einer unpersönlichen Symmetrie.
Auch zu Dzoni, der am Anfang noch gegen das Untergehen in der Masse zu kämpfen scheint, findet man später keinen Draht mehr. Während er beim ersten Schuss noch zögert, knallt er später Zivilisten ab, wie er vorher lästige Insekten tötete. Begreifen kann er das nicht einmal selbst, verständnislos schaut er auf seine Hand, die all das getan haben soll. Doch er ist nun einmal nur noch einer von vielen in einer Herde von Gewohnheitstieren. Sonnen, Rauchen, Saufen und ein bisschen Töten.
Vladimir Perisic zeigt, was außergewöhnliche Bedingungen aus gewöhnlichen Menschen machen können. Dass man sich als Zuschauer mit Dzoni anfangs noch zu identifizieren versucht hat, scheint unglaublich weit entfernt.
Kritik von Jenny Dreier und Claudia Kück (Hölty Gymnasium, Wunstorf)

Gewalt ohne Fragen
Erster Schuss. Unsicher, halb verfehlt.
Zweiter Schuss. Treffer.
Dritter Schuss. Kalt, das Kind fällt.
Vladimir Perisic zeigt in seinem Film „Ordinary People“ einen jungen Mann in Zeiten der Gewalt. „Normale Menschen“, die das Töten zum Beruf haben. „Normale Menschen“ in einer Welt, in der nicht hinterfragt wird.
In jedem Schuss, jedem Mord, sieht man in dem Protagonisten Dzoni die Veränderung durch die Gewalt. Wenn er den ersten Schuss noch unsicher und widerwillig abfeuert, so drückt er beim dritten Mal kalt und unbarmherzig ab. Woher kommt die Gewalt und was bewirkt sie? Das ist die zentrale Fragestellung des Films. Doch es bleibt bei der Frage, die Antwort liegt bei dem Zuschauer, so der Regisseur. Ein anderer wichtiger Aspekt des Films ist die Zeit. Zeiträume in denen Dinge geschehen, wie das Rauchen einer Zigarette und sei es auch die letzte, der Blick gen Himmel oder der Schuss, der die Stille zerreißt. Die häufigen Längen des Films sind ein wichtiger Bestandteil davon, auch wenn sie oft unerträglich erscheinen.
Durch die schlichte Arbeit von Kamera und Schnitt wird die simple Grausamkeit des Geschehens hervorgehoben. Auch die Idylle der Umgebung hat einen ähnlichen Effekt. Das Lichtspiel von Hell und Dunkel spaltet das Gesicht des Protagonisten in zwei Hälften und spiegelt seine innere Zerrissenheit wieder. Verdunkelungen sind Vorboten für das Kommende, das Helle symbolisiert die alten Ideale. Letztendlich gewinnt die Dunkelheit, gewinnt die Gewalt.
Erster Schluss. Jeder ist anfällig für Gewalt.
Zweiter Schluss. Gewalt zerstört Opfer und Täter.
Dritter Schluss. Zeit- steht in keiner Relation zu Gewalt.
Vladimir Perisic ist es gelungen, alle filmischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um darzustellen ohne zu urteilen.
Kritiken von Antonia Kölbl und Benedikt Hösl (Rudolf Steiner Schule, Gröbenzell)
Das Fremde Ich
Dzoni, ein junger Mann sitzt im Schatten eines Baumes. Er blickt auf seine Hände und streicht über eine Schwiele. Der Mann trägt eine Uniform. Die Schwiele, die er nachdenklich massiert – ein Zeichen redlicher Arbeit?
Seine Arbeit: Soldat. Es ist Krieg. Dzoni befindet sich mit seiner Truppe auf einem abgelegenen Grundstück, ein alter Bauernhof. Eine erdrückende Stille überdeckt die Landschaft. Eine unerträglich gleißende Sonne taucht den Ort in ein Licht, vor dem sich nichts und niemand verbergen kann. Der Ort wird ein Ort des Verbrechens. Dzoni weiß das noch nicht. Vielleicht ahnt er es. Dzoni wartet. Das unerträgliche Warten. Die Kamera wartet auch. Lange Zeit verharrt die Kamera in einer Einstellung. Sie ist auf ein Bild fixiert. Zusammen mit den anderen Soldaten und ihrem Offizier, dessen Sonnenbrille die Augen verbirgt. Er demonstriert ihnen, was von den jungen Soldaten verlangt wird: Menschen auf die Knie zwingen. Allen Kontakt vermeiden. Hinrichten. Dzoni zögert: „Ich kann nicht!“ Die Soldaten treten an. Er läuft hinterher. Gehorcht. Zieht mit. Vans fahren auf das Gelände. Verängstigte Menschen, unbewaffnet, eingeschüchtert werden aus den Wagen gestoßen. Werden vor die Wand gestellt. Dzoni schießt. Zittert. Schaut weg. Kann die Situation kaum ertragen. Kann sich nicht ertragen. Der anfängliche Widerstand bröckelt. Dzoni passt sich der Situation an. Er „fühlt sich ein“. In seine neue Rolle. Nicht in seine Opfer.
Vladimir Perisic betont, dass er universell zeigen will, dass ganz normale Menschen – eben keine Monster – töten. Dass sie sich verändern – auch durch unnatürliche Entwicklungen. Veränderung von einer ,,ordinary person“ zu einem mit Schuld beladenen Menschen.
Im Gespräch aber geht der Regisseur erstaunlich wenig auf die eigene Geschichte, die Geschichte seines Landes, seines Volkes ein. Doch genau diese Vorgänge und Massaker sind Teil der Geschichte Serbiens, unterstreichen die Echtheit des Dargestellten – übrigens durchweg gespielt von Laiendarstellern - geben ihm eine schrecklich authentische Signatur.
Kritiken von Esra Kacan und Julia Balla (Ottheinrich Gymnasium, Wiesloch)
Diese Kritiken sind entstanden im Rahmen von La Toute Jeune Critique
Semaine internationale de la Critique de Cannes 2009.
Zur Übersicht der Semaine Internationale de la Critique de Cannes 2009

















Kommentare zu „Ganz Junge Kritik in Cannes - Ordinary People“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.