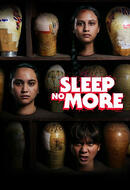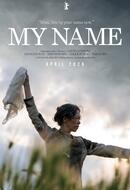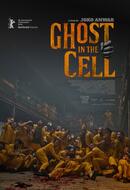Zwischen gestern und morgen – Kritik
Neu auf DVD: Normale Leute in den Klauen spaßbefreiter Unmenschen. In Harald Brauns Zwischen gestern und morgen (1947) erscheint Deutschland als erstes von den Nazis besetztes Land, in dem nur ein paar wenige und grundsätzlich die anderen schuld waren.

Aus vier Perspektiven wird von einem Mord erzählt. Der Erzählende bezichtigt sich dabei jeweils, der Mörder zu sein. Die verschiedenen Versionen ähneln sich, sind aber letztlich nicht ansatzweise zu vereinen. Zu sehr stehen zentrale Aspekte in Widerspruch zueinander. Mit diesem Konzept sorgte Rashomon 1951 bei den Filmfestspielen von Venedig international für Aufsehen. Zwischen gestern und morgen kam vier Jahre vorher in die deutschen Kinos. Darin wird von einem Tag und einer Nacht in einem Hotel erzählt – aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Vielleicht hätte der unter der Regie von Harald Braun entstandene Film anders ausgesehen, wäre er nach 1951 entstanden, denn eigentlich schreit die Geschichte nach einer ebensolchen Widersprüchlichkeit.
Eine Liebesgeschichte, klar und aufgeräumt

Maler Michael Rott (Viktor de Kowa) kommt nach Kriegsende aus dem Schweizer Exil nach München zurück und erinnert sich in den Ruinen eines Hotels: wie er an einem Abend vor zehn Jahren an gleicher Stelle eine Hitler-Karikatur malte, wie er mit Anette (Winnie Markus) die Nacht verbrachte – es war ein Eheversprechen – und wie er wegen des Bildes Hals über Kopf vor den Häschern der Gestapo fliehen musste. Als er Anette in der Jetztzeit wiedertrifft, unterscheidet sich ihre Geschichte der Nacht aber. Sie weiß nichts von der Karikatur. Dafür von einem wertvollen Schmuckstück, das Michael anvertraut wurde und das mit ihm verschwand – umgehend nachdem er „ihre Unschuld“ geraubt hat.

Epistemologisch ist Rashomon der gewagtere Film. Zwischen gestern und morgen lässt bei den beiden Versionen des Abends keine Widersprüchlichkeit zu. Auch wenn die Erzählenden zu unterschiedlichen Interpretationen der Geschehnisse kommen, wird uns eine „objektive“ Wirklichkeit gezeigt, die schlicht zu einem Missverständnis führt. So ist in der zweiten Rückblende zu sehen, wie Michael das Schmuckstück dem Empfänger in den Briefkasten steckte, statt es ihm zu übergeben. Mittels eines dritten Sprungs in die Vergangenheit wird dann noch nachgereicht, was aus diesem wurde. Die Liebesgeschichte ist bei aller Tragik, die aus den unterschiedlichen Sichtweisen entspringt, klar und aufgeräumt.
Lieber leichte Lösungen als zu viel Aufregung

Diese Simplizität entspricht der allgemeinen Ausrichtung des Films. Der allgegenwärtigere Vergleich, den Zwischen gestern und morgen bietet, ist der zwischen dem Regina-Palast-Hotel 1938 und 1947. Zwischen einem Prunk, hinter dem die Häscher des Naziregimes lauern, und den Trümmern, die direkte Folge dieser Vergangenheit sind. Hier das hauseigene Schwimmbad, in dem fröhlich geplanscht wird, dort als Match Cut dasselbe Becken, das nun behelfsmäßig als Kantine herhält. Hier ein Flur, der zu einer Tür führt, hinter der die Liebe wartet, dort Kabel, die von der Decke hängen, und Türen, die ins Leere einer zerstörten Stadt führen. Und weil die Vergangenheit eben nicht so einfach ist, möchte es Zwischen gestern und morgen seinen Zuschauern scheinbar umso einfacher machen.

Die Hauptdarsteller Viktor de Kowa und Hildegard Knef – als keckes Trümmermädchen Kat – spielen locker-leicht auf. Sichtlich sind sie da, um Arglosig- und Aufrichtigkeit zu verströmen. (Wenn die Knef dann tatsächlich eine dramatische Szene spielen muss, wirkt sie auch gleich verloren und bietet aufgedrehtes Overacting.) Und auch das Tragische der Liebesgeschichte verläuft im Sand, statt melodramatisch zu werden. Lieber leichte Lösungen als zu viel Aufregung.
„Du und deine verdammten Nazis“

Dass weitflächig in Rückblenden erzählt wird, öffnet trotzdem die Möglichkeit für implizite Widerhaken, die Zwischen gestern und morgen genauso ausmachen wie seine vorgeschobene Unkompliziertheit. Schon zu Beginn: Immer wieder werden Absprungpunkte für Rückblenden geboten, und doch bleibt die Geschichte im Hier und Jetzt. Als sich zunehmend aufdrängt, dass uns ein Deutschland gezeigt wird, das von seiner Vergangenheit abgetrennt ist, das keinen Blick zurück wagt, setzen sie dann doch ein. Und dort finden wir – egal wer erzählt – ein Deutschland, in dem sich die „normalen“ Leute in den Klauen von spaßbefreiten Unmenschen befinden. Und jeder Rückblick zeigt zuerst den oder die Rückblickenden, wie er oder sie sich in Opposition zum Regime befindet. Späße auf Kosten der Nazis werden in die Welt posaunt, und jüdischen Frauen werden gegen jede Regel Räume in Luxushotel gegeben. Schuld? Schuld hatten doch nur die anderen. „Du und deine verdammten Nazis“, wie eine Frau zu ihrem Ehemann im Bombenhagel sagen wird. Die anderen, aber nicht die Protagonisten.
Porträt eines verzweifelten Wegblickens

Die Arglosigkeit, mit der zurückgeschaut wird, führt anschaulich vor Augen, wie schnell die Erzählung bereitlag, dass Deutschland das erste von den Nazis besetzte Land war, dass es nur ein paar wenige und grundsätzlich die anderen waren. Es war 1947 sichtlich nicht so einfach, dem noch frischen Entsetzen ins Auge zu blicken. Und wenn im Film das Leben in Nazideutschland nicht ganz so grimmig scheint, dann ist es gerade deshalb bitter und klamm. Der Film ist nicht nur spannendes Zeitdokument, sondern auch Porträt eines verzweifelten Wegblickens.

Zumal es eben noch den Nebenplot von Nelly (Sybille Schmitz) gibt. Die Geschichte einer jüdischen Frau, die es in ihrem Versteck nicht länger aushält und nochmal eine Nacht ihr altes Leben wahrnehmen möchte. Die in einem Hotelbett schlafen und duschen möchte. Die vor Ort auf ihren Ehemann (Willy Birgel) trifft, der sich aus Angst vor dem Ende seiner Karriere von ihr scheiden ließ und der nicht nur wieder für sie entbrennt, sondern auch von seinem schlechten Gewissen zerfressen wird. Die auf die Gestapo trifft. So sehr Zwischen gestern und morgen das Grauen der jüngsten Vergangenheit zu kaputten Häusern anonymisiert, so sehr weiße Westen ausgegeben werden, so sehr stimmt es auch, dass es im Geschehen des Films nur ein Todesopfer gibt: Nelly, die ins Konzentrationslager gebracht wurde und keine Perspektive mehr in dieser scheinbar arglosen Selbstbestätigung hat.
Neue Kritiken

Ella McCay

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

No Other Choice

Ungeduld des Herzens
Trailer zu „Zwischen gestern und morgen“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (17 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.