Zama – Kritik
Fast zehn Jahre hat die argentinische Regisseurin Lucrecia Martel für ihren neuen Film gebraucht. Zama erzählt von Kolonialherren, die an ihrer eigens geschaffenen Welt zugrunde gehen – und lenkt den Blick dabei auf das Unsichtbare.

„Ich tue für euch, was niemand für mich tat. Ich zerstöre eure Hoffnungen“, sagt Diego de Zama (Daniel Giménez Cacho) am Ende dem habgierigen Banditen. So viel Erbarmen hat Zama für seinen titelgebenden Helden nicht. Der Film zerstört keine Hoffnungen, sondern lässt sie geduldig erodieren. So wie alles andere in diesem Film mit quälender Langsamkeit erodiert, fault, sich zersetzt, seinem Ende entgegenschreitet; zuvorderst die Körper, die nicht hierhin gehören. Aber Zama verweigert sich gekonnt dem Umschlagpunkt, der Gnadenstoß bleibt aus. Er kann nicht sterben, sagt ein rätselhafter Junge am Anfang über Zama, und so verhält es sich mit Zamas Hoffnung: Keiner erlöst ihn von ihr.
Und das Land lachte

In nur wenigen Einstellungen führt Lucrecia Martel in die Grundstimmung von Zama ein. Ein Mann in prachtvoller Montur steht am Strand und rückt bis ans Wasser vor. Der grimmige Blick in die Ferne ist kein Blick der Eroberung, keiner, der sich den Raum zu eigen macht, ehe er ihn unter seine Gewalt bringt. Es ist ein Blick, der nicht die Weite sieht, sondern den Trug des Weiten erkennt. Diego de Zama, Offizier der spanischen Krone, steckt in diesem Provinzort an der Küste Südamerikas fest und wartet vergeblich auf seine Versetzung. Zama ist nicht die Geschichte dieser Versetzung, sondern ein Film des Wartens; das Verwalten der verschwindend geringen Hoffnung, dass dieses Warten einen Sinn hat.
Zu Beginn soll ein gefesselter Einheimischer ein Geständnis ablegen; stattdessen erzählt er die Geschichte eines Fisches, der vom Wasser abgewiesen wird und in ständigem Hin und Her seine Existenz darin immer wieder aufs Neue erringt. Für Martel ist Zama dieser Fisch, der Film zeigt einen Mann, der zwar feststeckt, aber gleichzeitig Fremdkörper bleibt und das Land nie ganz unter seine Herrschaft zwingen kann. Zama findet dafür eine großartige Szene, als sein Protagonist am Strand steht und ein Kichern hört, es zunächst nicht verorten kann, dann auf einheimische Frauen stößt, die sich mit Schlamm einreiben. In diesem unbehaglichen Kichern vereinen sich nicht nur diese wenigen Frauen, sondern, so scheint es, alle sogenannten Ureinwohner; ja dieses unbezwingbare Land selbst lacht Zama aus, gibt ihm zu verstehen, dass er es niemals durchdringen wird. Dann jagt es ihn, in Gestalt der schlanken und flinken Malemba (Mariana Nunes), ein nackter, schwarzer Körper hinter diesem geschwächten Körper in pompöser Kleidung. Die Ohrfeige, die ihr Zama schließlich verpasst, kann die Demütigung nicht tilgen.
Feine Manieren im Schlamm

Doch der Film muss keine Frauen auf Zama hetzen, um ihn bloßzustellen. Die Kolonialherren genügen sich, dekonstruieren laufend selbst ihr Heldentum und ihre zivilisatorische Mission. Die kleine Gemeinschaft, die ihre Manieren und ihre Kleidung aus Spanien mitgebracht hat und sie erhobenen Hauptes in der Hitze, in der Feuchte, im Schlamm und im Fieberwahn trägt, hat etwas Absurdes, schön überspitzt in der Szene, in der die Frau des Schatzmeisters (Lola Duñeas) beklagt, dass es in dieser Einöde nichts zu beklatschen gibt und daraufhin zu applaudieren beginnt. Martel schöpft dieses komische Element, die immerwährende Schrägheit aus, lässt den einheimischen Boten Perücke und Jackett tragen, aber in Unterhose und barfuß. Unter den selten zurechtgerückten Perücken lugt dreckiges Haar, die Gesichter sind nass vom Schweiß, der Choleradurchfall zwingt die selbsternannten Herren in die Knie. Ein Lama platzt in die Begegnung zwischen Zama und dem Gouverneur. Die Atmosphäre in Zama pendelt zwischen dem Komischen und dem Unheilvollen, verweigert sich der Eindeutigkeit; gibt es kurz Ruhe, bricht jäh die den Film kennzeichnende Beunruhigung wieder ein.
Diese Eroberer, die sich elegant ihrer nicht zuletzt moralischen Fäulnis hingeben, werden von Geistern heimgesucht, als schwebten sie schon zwischen Leben und Tod. Immer wieder bricht das Fantastische in Zama ein, begleitet von nicht zu identifizierenden Hintergrundgeräuschen – Rasseln, Schreien, Lachen vielleicht –, denen genauso viel Bedeutung eingeräumt wird wie den Dialogen. Die Körper werden zu prophetischen Sprachrohren, durchzuckt von Wahrheiten, die in Wirklichkeit möglicherweise gar nicht ausgesprochen werden; vielleicht bilden sich die Verdammten lediglich ein, dass andere ihr ungutes Gefühl in Worte kleiden. Auch die Figur des vielgefürchteten Banditen Vicuña Porto (Matheus Nachtergaele) hat etwas von einer immerwährenden Projektion: Tausendmal für tot erklärt, versetzt er die Spanier dennoch in Angst und Schrecken, ist Phantom und Gerücht, Symbol der alles umspannenden Ungewissheit, die das Leben der Kolonialherren prägt. Symbol vielleicht auch eines schlechten Gewissens.
Die Gewalt der Unsichtbarkeit

Zama ist ein Film über Diego de Zama. In seinem wenig plotgetriebenen Mäandern ist Martels Film fast immer bei ihm, nah an seinem Gesicht, von dem aus er die Regungen des Mannes verfolgt. Doch Diego de Zama ist ein Produkt der Welt, an deren Erschaffung er mitwirkt, und damit ist Zama auch ein Film über die, gegen die sich die Gewalt dieser Welt richtet. In seiner Fokussierung auf den Kolonialisten reproduziert Zama ein Unsichtbarmachen, aber diese Unsichtbarkeit prangt derart in diesem Film, dass sie die Aufmerksamkeit letztlich auf die lenkt, deren Existenzen unbeantwortet bleiben. In Zama tummeln sich unter den Einheimischen die Versehrten: Es gibt Stumme, Blinde, Amputierte. Die Gewalt, die ihnen widerfahren ist, wird nicht gezeigt; die Frage nach dieser Gewalt drängt sich umso mehr in den Vordergrund.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Zama“



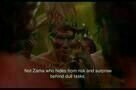
Trailer ansehen (4)
Bilder
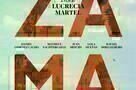



zur Galerie (10 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.
















