Yannick – Kritik
Mubi: Ein unzufriedener Theaterzuschauer nimmt Schauspieler und Publikum in Geiselhaft. Quentin Dupieux' Yannick wirkt dabei beinahe entspannt und unterstreicht das Menschliche seiner allegorischen Figuren.

Während eines Theaterstücks, das davon handelt, dass ein Ehemann den neuen platonischen Freund seiner Frau festhält und eine für alle unangenehme Situation schafft, steht ein Zuschauer namens Yannick (Raphaël Quenard) auf und unterbricht die Aufführung. Er setzt den Schauspielern auseinander, dass er extra einen Tag freigenommen habe, 45 Minuten Zug gefahren und 15 Minuten zum Theater gelaufen sei – und nun, nun amüsiere er sich nicht. Statt Ablenkung von seinen Problemen bekomme er nur ein weiteres serviert. Für seinen Aufwand und sein hart erarbeitetes Geld erhalte er keinen Gegenwert, sondern nur Langeweile. Da müsse doch etwas unternommen werden. Yannick findet wenig Verständnis, wird beschimpft und verspottet, weshalb er eine Pistole zieht Schauspieler und Publikum festhält und für alle eine unangenehme Situation schafft.
Allegorie, dick unterstrichen
Die knappe Laufzeit – Yannick dauert kaum mehr als eine Stunde – bedingt, dass in diesem Setting nicht allzu viele Haken geschlagen werden. Yannick diskutiert, die Situation eskaliert, Yannick schreibt ein neues Stück, er unterhält sich mit dem eingeschüchterten Publikum, der Darsteller des Ehemanns (Pio Marmaï) schafft es, die Pistole an sich zu nehmen, entschärft die Situation aber nicht, ein neues Theaterstück kommt zur Aufführung. Dick wird dabei unterstrichen, dass es sich dabei um eine Allegorie handelt und nicht um einen dramatischen Spielfilm.
Nichts neues also bei Quentin Dupieux, wäre sein Film nicht dermaßen spartanisch und entschlackt. Der Theatersaal wird nur für wenige Momente verlassen, oft nur, um die ausgestorbenen Gänge des Hauses zu zeigen, also die Leere, die die intensive Situation umgibt. Ebenso klar ist die filmische Form. Sachlich wird inszeniert, wie Leute miteinander reden. Nur hin und wieder werden Bild und Ton expressiv. Beispielsweise wenn Yannick an einem Laptop sitzt und mit seinem linken Zeigefinger langsam vor sich hin tippt – mit der rechten muss er ja weiterhin die Pistole halten. An dieser Stelle gibt es einzelne Klaviertöne, die die Atmosphäre in ihrer klirrenden Kälte hörbar machen.

Mit anderen Worten, ein Regisseur, der es seit seinem ersten (Fast-)Langfilm – Nonfilm (2002) hatte eine Laufzeit von 48 Minuten – immer wieder schafft, seine Ideen so gnadenlos totzureiten und zu überfrachten, dass seine Werke gefühlt viel, viel länger dauerten, als die Uhr einem weismachen wollte, hat es geschafft, einen konzentrierten Film zu machen, der sich auf eine Idee beschränkt. Einen Film, der nicht auf Sperenzchen aus ist, sondern das Menschliche seiner allegorischen Figuren unterstreicht.
Diesmal ist bei Dupieux also nicht das Konzept zentral, sondern die Schauspieler. Meist fungieren die Figuren zwar als Stichwortgeber, aber doch schaffen es alle, nicht zu diesen zu verkommen. Vor allen anderen ist Raphaël Quenard in der Titelrolle sehenswert, ein Lausbub, der kein soziales Verständnis zu haben scheint. Gnadenlos subjektiv nimmt er die Welt wahr und versteht gar nicht, dass er gegen Normen verstößt, dass er andere Menschen in seinen Frust mit hineinzieht, wie unangenehm seine Plaudereien mit den Zuschauern sind, die sichtlich versuchen, den labilen jungen Mann nicht zu provozieren. Quenard spielt keinen Bösewicht, sondern einen Verlorenen, einen Jungen, mit dem wir – für das Ende ist das nicht unwichtig – mitfühlen können. Pio Marmaï wiederum gibt den Schauspieler, der sich ständig seinen öligen Scheitel mit der ganzen Hand nachzieht, herrlich schmierenkomödiantisch.
Eine sich materialisierende Kommentarspalte

Wovon die Allegorie handelt, sollte inzwischen halbwegs klar sein. Vom Film- und Theaterkonsum in einer Zeit, in der Leute zwischen ihren Medien leichter denn je hin und herschalten können und dabei stets verlangen, bestens unterhalten zu sein. Gewissermaßen ist Yannick eine sich materialisierende Kommentarspalte dazu. Es geht um den Konflikt zwischen Leuten mit unterschiedlichem kulturellem Kapital, um den Unterschied zwischen naiver Kritik und selbstherrlichem, ätzendem Abkanzeln. Darum, dass Verhohnepipelung immer noch besser funktioniert als ironisch-intellektuelle Aufarbeitung, dass ein Stück über schlechten Mundgeruch besser ankommt als das schmissige Infragestellen moderner Beziehungen.
Gerade Letzteres nimmt sich Dupieux zu Herzen. All die Themen behält er als Subtext bei, der zwar aus der Situation sehr deutlich wird, der einem aber nicht aufgezwängt wird. Stattdessen eben ein Theatersaal, eine Handvoll Leute und eine klare Situation, die einfach abläuft. So ist Yannick etwas geworden, was bisher bei Dupieux kaum möglich schien: ein nahezu entspannter Film.
Den Film gibt es ab 05.04.2024 bei MUBI.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Yannick“
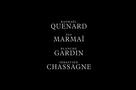
Trailer ansehen (1)
Bilder



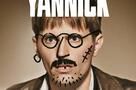
zur Galerie (4 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.














