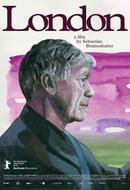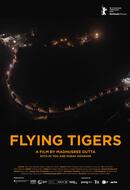Wir könnten genauso gut tot sein – Kritik
VoD: Ein brutalistischer Wohnblock ist das letzte Refugium vor der dystopischen Außenwelt. Wir könnten genauso gut tot sein zeigt, wie Isolation und kollektive Paranoia die Gemeinschaft zersetzen.

Wo andere mit Establishing Shots oder einer nebensächlichen Tätigkeit einsetzen, wirft Regisseurin Natalia Sinelnikova ihr Publikum direkt hinein ins Geschehen: Eine vornehm gekleidete, dreiköpfige Familie hetzt Hand in Hand durch den Wald, der Vater trägt eine Axt mit sich, die Mutter einen Hammer. Nervös blicken sie immer wieder nach hinten, um sicherzustellen, dass ihnen ja niemand folgt. Endlich stehen sie vor einem großen, umzäunten Grundstück, in dessen Mitte ein brutalistisches Hochhaus thront. Von innen öffnet ihnen jemand das Tor zu dieser gated community. „Intra muros tuti sumus“, singt ein Chor dazu. Innerhalb der Mauern sind wir sicher.
Nur drei Szenen von Wir könnten genauso gut tot sein (2022) spielen außerhalb dieses Grundstücks. Warum genau die Bewohner*innen sich auf dem Areal verschanzt haben, zeigt der Film nicht – wohl auch aus Budget-Gründen. Das ist aber auch gar nicht nötig, denn allein schon die Panik in den Augen der dreiköpfigen Familie, die sich um eine Wohnung in der Gemeinschaft bewirbt, lässt erkennen, dass die Gesellschaft außerhalb des Zauns in den Hobbes’schen Naturzustand zurückgefallen sein muss. Doch ausgelöst durch kleinere Vorfälle beginnt die Zivilisation bald auch innerhalb der Mauern zu bröckeln.
Beobachten und beobachtet werden

Die Kameraarbeit von Jan Mayntz übersetzt die zunehmende Paranoia der Bewohner*innen in permanente Beklemmung: Immer wieder zoomt oder fährt die Kamera langsam hinein, als lauere hinter jeder Ecke, hinter jeder Topfpflanze ein verdeckter Beobachter. Verzerrende Aufsichten und bedrohliche Untersichten verstärken diesen Effekt ebenso wie nervöse, monotone Streicherklänge. In gewisser Weise ist Anna (Ioana Iacob) die stille Beobachterin: Sie arbeitet als Sicherheitsbeauftragte des Hauses, steuert die Überwachungskameras und prüft bei ihren täglichen Kontrollgängen, ob der Zaun des Grundstücks unbeschadet ist.
Doch tatsächlich sind hier alle Beobachtende und Beobachtete zugleich: Konzerte und Gemeinschaftsabende mögen eine heile Welt simulieren, aber die argwöhnischen Blicke und spitzen Kommentare in gestelzter, voller falscher Höflichkeit steckender Sprache machen klar, dass hier Misstrauen und Konkurrenzdenken regieren. Spätestens als die Guru-artige Oberaufseherin einzelne Mitglieder für Verstöße bestraft und mit Eignungsprüfungen neu darüber entscheiden will, wer bleiben darf und wer aus der schützenden Gemeinschaft verbannt wird, drängen diese Elemente immer mehr an die Oberfläche.
Gefangen in steter Beunruhigung

Natalia Sinelnikova ist mit ihrem Langfilmdebüt ein kompakter, effizienter Psychothriller über destruktive Gemeinschaftsdynamiken unter dem Druck klaustrophobischer Extremsituationen gelungen. Gerade ihre Entscheidung, die feindliche Außenwelt nicht auszubuchstabieren, macht sich bezahlt – denn so muss jede Zuschauerin und jeder Zuschauer die eigenen dystopischen Szenarien hineinprojizieren. Dem Film kommt dabei auch zugute, dass Sinelnikova und ihr Team die filmischen Mittel des Foreboding spürbar beherrschen und das Publikum so in einem Zustand der steten Beunruhigung gefangen halten.
Diese andeutungsreiche Arbeitsweise und der politische Subtext des Films erinnern zuweilen an die Greek Weird Wave. Das setzt sich fort in kleinen, grotesken Randnotizen wie einer Figur, die die Selbstisolation ins Extrem treibt und sich über Wochen im Badezimmer einschließt, um andere vor dem Unheil ihres „bösen Blicks“ zu schützen. Vielleicht ist es da kein Zufall, dass etwa in der Mitte des Films ein griechisches Lied erklingt.
Man kann Wir könnten genauso gut tot sein in Teilen als Corona-Parabel lesen, wenn der Plot zeigt, wie durch Isolation und Klaustrophobie eine kaum bremsbare kollektive Hysterie entsteht, die die Gemeinschaft spaltet. Der Film lässt sich aber auch Illustration eines viel universelleren Themas deuten: der Dialektik der Exklusion. Wer andere aussperrt, sperrt sich selbst ein.
Der Film steht bis zum 02.05.2024 in der ARD-Mediathek.
Neue Kritiken

AnyMart

Allegro Pastell

A Prayer for the Dying

Gelbe Briefe
Trailer zu „Wir könnten genauso gut tot sein“


Trailer ansehen (2)
Bilder




zur Galerie (4 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.