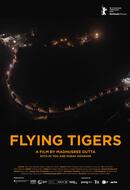Widows - Tödliche Witwen – Kritik
Steve McQueen wagt sich mit Widows ins Heist-Genre und verschaltet einen All-Female-Beutezug mit einem Wahlkampf in Chicagos South Side. Was ist Wahlkampf auch anderes als ein Beutezug?

Gleich mal alles gleichschalten: Widows geht in medias res und parallelmontiert morgendliche Bettszene an wilde Verfolgungsjagd; die aufgeregte Tonspur lässt die eigentlich beruhigten Aufweck-Schmatzer nahtlos übergehen in die platzenden Patronen der Schüsse, die von der Ladefläche des Vans in Richtung jagende Cops abgegeben werden, bevor es wieder zurück ins Bett geht, und so weiter. Ehe und Raub, Harry Rawlings (Liam Neeson) ist mit beidem vertraut, er ist die einzige Verbindung, die wir in dieser Anfangssequenz herstellen können, weil er in beiden Teilen der Parallelmontage dabei ist, einerseits im Bett liegt, mit seiner Frau Veronica (Viola Davis), andererseits am Steuer des Vans sitzt und wohl irgendwie irgendwo rauskommen muss nach einem großen Coup. Bettszene und Verfolgungsjagd finden also nicht synchron statt, die Parallelmontage porträtiert schlicht die zwei Seiten einer Gleichung, für die uns an dieser Stelle noch allerlei Variablen und Vorzeichen fehlen.
Genre-Flug mit Turbulenzen

Was schon der Titel erahnen lässt, wird als Nächstes geklärt: Die Flucht geht schief, der Van explodiert, die Gang ist tot, vier Frauen verwitwet und jeweils mit einem Riesenchaos zurückgelassen. Mit dem größten kämpft Veronica, sie wird bedroht, weil mit dem Auto auch ein ganzer Batzen Geld in Flammen aufging, der natürlich jemandem gehörte. Einziger oder, vielleicht besser, vom Drehbuch gewählter Ausweg ist das vom Toten hinterlassene Notizbuch mit geplanten Raubzügen, das jetzt in Frauenhand ist, dessen Inhalt jetzt zur Frauensache wird.

Man merkt’s ja schon, viel Plot für einen Film von Steve McQueen, der sich bislang eher auf intensive Grundkonstellationen denn auf extensive Storylines verließ: Hungerstreik, Sexsucht, Sklaverei. Auch wenn er mit Widows schließlich recht sicher im Genrehafen landet, geht sein Flug durch heistige Höhen nicht ohne Turbulenzen vonstatten; man merkt dem Stoff mitunter durchaus an, dass er vom Kino nur adoptiert wurde, dass seine leibliche Mutter eine deutlich ausführlichere TV-Miniserie war, in der mehr Zeit für Exposition, mehr Raum für die einzelnen Mitglieder der Witwengang war. Veronica holt sich nämlich Hilfe von zwei der anderen Witwen, die keinesfalls Tough-Woman-Klischees sind, sondern ganz konkret mit hinterlassenen Schulden, Kindern und Geschäften ihrer Männer zu kämpfen haben – und später entpuppt sich noch eine Nanny als perfekte Fahrerin für den großen Coup.
Raub als conditio urbana

Und dann gibt’s da noch das Setting, in das McQueen und Mitautorin Gillian Flynn die ursprünglich in London spielende Story versetzt haben: die mittlerweile fast ausschließlich afroamerikanisch geprägte South Side Chicagos. Die ist nicht nur Schauplatz von Verfolgungsjagden, sie ist vor allem umkämpfter öffentlicher Raum, steht im Mittelpunkt von Gentrifizierung und Segregation und wird von einem lokalen Wahlkampf heimgesucht, in dem es der jüngste Schützling des weißen Mulligan-Clans (Colin Farrell) erstmals mit einem schwarzen Gegenkandidaten zu tun hat. Und Jamal Manning (Brian Tyree Henry) hat nicht nur einen gewieften und brutalen Kampagnenmanager (Daniel Kaluuya) für die Drecksarbeit, er ist es auch, dem Meisterdieb Harry das Geld entwendet hat und der es nun von Veronica zurückfordert.

Und so fügen sich hier Genre und Stadtpolitik zusammen, manchmal etwas ächzend, häufig aber doch organisch. Man hat hier nicht das Gefühl, ein Genrefilm sei mit politischer Relevanz gepimpt worden (höchstens in einer Rückblende, in der ein junger Schwarzer unter den von einem Wahlplakat herunterlinsenden Augen Obamas von einem Cop erschossen wird) oder ein Messagefilm in Genreklamotten gekleidet, die ihm eigentlich nicht passen. Die Verschränkung funktioniert, weil, so banal das vielleicht klingt, Verbrechen und Politik nun einmal eng zusammenhängen, weil auch und gerade in der Stadtpolitik alles am Geld hängt. Raub ist hier kein Genrelement, sondern conditio urbana.
Kamerafahrt als Stadtporträt

Weil er so viel erzählen muss, hat McQueen in Widows weniger Raum für seine andernorts manchmal ins Poserhafte kippenden Übungen, mit denen er die Extreme menschlicher Erfahrung ins Filmische zu übertragen versucht. Eine der wenigen Szenen, in denen sich die Inszenierung doch mal in den Vordergrund drängelt, gehört dann auch gleich zu den schönsten des ganzen Films: Nach einem fies paternalistischen Wahlkampfauftritt, auf dem Mulligan sich für sein Starthilfe-Projekt für junge schwarze Unternehmerinnen feiern lässt, fährt er zurück in seine Gated Community. Dabei bleibt die Kamera die gesamte Fahrt über auf der Motorhaube des Autos und schwenkt umher, nimmt behutsam den städtischen Raum und die harten Übergänge zwischen Arm und Reich in den Blick, während sich auf der Tonspur der zuständige Politiker dafür kaum weniger interessieren könnte. Da wird klar: Eigentlich ist nicht die Stadt Setting für den Heist-Film, der Heist-Film ist Setting für ein Stadtporträt.

Aber dann ist irgendwann auch die Bühne frei für die Witwen und ihren Coup, und damit auch für die durch die Bank weg tollen Darstellerinnen, die aus ihren tragischen Figuren ein kampffähiges Kollektiv basteln. Sie buhlen dabei nie um Zuschauersympathie. Das ist vielleicht ein schöner Nebeneffekt davon, wenn Serienstoffe ins Kino übertragen werden. Das geht nicht ohne Verluste, aber Verluste können ja toll sein. Die Figuren bleiben noch ein wenig erratisch, unverstanden, damit autonom, und uns bleibt nichts übrig, als ihnen zu folgen, ein bisschen wie der kleine weiße Hund, den Veronica nach dem Tod ihres Gatten nun am Hals hat und überall mit hinschleppt, der lange Zeit zwischen Metapher und Running Gag changiert und schließlich doch Entscheidendes erschnüffeln darf.
Neue Kritiken

No Good Men

Die Reise von Charles Darwin

Der große Wagen

Ella McCay
Trailer zu „Widows - Tödliche Witwen“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (22 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.