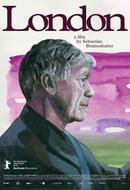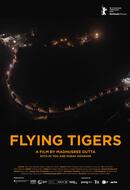Das Glücksrad – Kritik
Ryusuke Hamaguchi erzählt in Das Glücksrad von der Magie, die in den Dramaturgien des Lebens stecken, feiert den Zufall und die Sinnlichkeit des Sprechens.

„I didn’t know conversations could be that erotic“, schwärmt Tsugumi (Hyunri) von ihrem letzten Date. Nur geredet habe sie mit dem Typen, versichert sie Meiko (Kotone Furukawa) im Taxi, wirklich. Später stellt sich heraus, dass es sich bei dem Traumdate um Meikos Ex-Freund Kazuaki (Ayumu Nakajima) handelt, der sie vor Jahren verlassen hat. Hoppla. Die junge Frau mit dem akkuraten Bob-Haarschnitt weiß nicht so recht, wie sie sich dazu verhalten soll, wenn Tsugumi und Kazuaki anbandeln. Fühlt sich so Eifersucht an? Vielleicht liebt sie ihn ja doch noch irgendwie, könnte schon sein. Oder was sind diese Gefühle, die sich da bemerkbar machen, die aber Meiko nicht zu fassen bekommt?
Ein Zyklus der Zufälligkeit

In eben solche hübschen, komplizierten Irrungen und Wirrungen begibt sich Ryusuke Hamaguchi mit seinem Beitrag zum Wettbewerb der aktuellen Berlinale-Ausgabe, in dem mehr über Frauen erzählt wird, als Filme von ihnen gezeigt werden. Drei Kurzgeschichten entwirft Hamaguchi in Das Glücksrad, die weibliche Figuren in den Fokus nehmen, mit doppeldeutig-ironischen Titeln versehen; die erste (Magic (or something less assuring) mit Meiko, Tsugumi und Kazuaki; die zweite (Door Wide Open) mit der verheirateten Nao (Katsuki Mori), die vom enttäuschten Sasaki (Shouma Kai) dazu angestiftet wird, Schriftsteller und Literaturprofessor Segawa (Kiyohiko Shibukawa) zu verführen; am schönsten vielleicht die letzte Episode (Once Again), die von einer Welt berichtet, die sich wegen eines Computervirus zurück ins Analoge bewegt. Nana (Aoba Kawai) und Moka (Fusako Urabe) begegnen sich an einer S-Bahn-Station, erkennen sich und verkennen sich doch, beide halten einander für andere. Aber sie verabreden sich zum gemeinsamen Spiel, zum So-tun-als-ob, sodass ihre Sehnsüchte und alles, was vergessen geglaubt war, aus den Körpern hervorgespült und erinnert wird, Begehren endlich gelebt werden kann.

Ein melancholisches, immer gleiches Klavier-Thema begleitet diese Fragmente aus dem Zyklus der Zufälligkeit, den Hamaguchi aufspannt. Bemerkenswert an diesem Triptychon, dessen Teile lose miteinander in Beziehung stehen (und dessen zweiter Teil sich gar nicht so sehr als Kernstück lesen lässt), ist die Sinnlichkeit des Sprechens, die sich zwischen den Figuren entfaltet. Yukiko Iiokas Kamera löst sie in ihren Drehungen auf, hält drauf und dagegen, beobachtet die epischen Verwandlungen der Fremden in Bekannte und wieder zurück. Das Glücksrad zeugt von der Unsicherheit, die mal im Gegenüber, mal im Selbst wohnt, vom Ungesagten, Träumerischen, vom Sprung in der Zeit, den Hamaguchi in seiner Hoffnung auf Besserung zelebriert. Die Welt hält hier (Un-)Wahrscheinliches bereit, ganz c’est la vie, und Resignation bedeutet das nicht. Stattdessen legt Das Glücksrad die machtvollen Dramaturgien des Lebens offen, in denen sich Menschen bewegen, die von Menschen hervorgebracht werden, auch wenn es sich für die gelegentlich nicht so anfühlen mag. Schicksal und Glück ließen sie sich nennen; aber wir sind es, die zusammen am Rad drehen.
Neue Kritiken

Allegro Pastell

A Prayer for the Dying

Gelbe Briefe

"Wuthering Heights" - Sturmhöhe
Trailer zu „Das Glücksrad“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (7 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.