What's So Bad About Feeling Good? – Kritik
Epidemie des freundlichen Überschwangs mit ideologischer Nähe zu Freddy Quinn: Die vom Gute-Laune-Virus infizierten jungen Leute wollen keine Gammler mehr sein. What’s So Bad About Feeling Good (1968) enthält Entgleisungen von unerwarteter Schönheit.

Ihre eigene Welt hat sich eine Gruppe junger Leute in George Seatons What’s So Bad About Feeling Good im New Yorker Greenwich Village eingerichtet: Die Nächte sind samten funkelnde Mosaike aus Tanz, Rockmusik, buntem Licht, das besonders wehendes langes Haar schön zur Geltung bringt, und vermutlich nicht allzu harten Drogen; die Tage verbringen sie in den schummrig verdüsterten, lediglich von einer nackten, gossenromantischen Glühbirne beleuchteten Räumen einer Kommune, verschlafen, müßiggängerisch und auf eine recht theatrale Art missmutig. Einer der Männer trägt einen niedlich verschmierten Malerkittel und fertigt kitschnahe Rätselbilder an, eine der Frauen spielt Gitarre und singt pessimistische Innerlichkeitssongs. Eine andere lebt tagaus, tagein in einem Kartoffelsack. Mit ihrer schlechten Laune meinen sie es allesamt, hat man den Eindruck, nicht allzu ernst.
Rumhängerfantasie mit gelassen-delirantem Glamour

In Deutschland hätte man die Truppe damals Gammler genannt, in den USA eher Beatniks als Hippies, obwohl die große Zeit der Ersteren 1968, im Erscheinungsjahr des Films, schon eine Weile vorbei war. Die Zuwendung zur Jugend hat so gesehen von Anfang an etwas Anachronistisches, was auch darauf verweist, dass es sich bei What’s So Bad About Feeling Good (der in deutschen Kinos unter dem leicht irreführenden Titel Hochzeitsnacht vor Zeugen lief) keineswegs um das Selbstporträt einer gegenkulturellen Bewegung handelt. Seaton entstammt einer deutlich älteren Generation, und sein Film ist ein klassisches Studioprodukt. Genauer gesagt: ein Versuch des alten, krisengeplagten Hollywoods, eine neue Zeit mit den Mitteln des alten Kinos abzubilden.
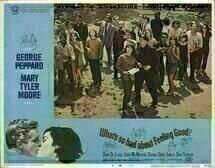
Das kann nicht ganz gut gehen und tut es auch nicht … aber andererseits generiert das kommerzielle Kino eben auch und vielleicht gerade in seinen Entgleisungen immer wieder erstaunliche, unerwartete Schönheiten. Die Anfangspassagen von What’s So Bad About Feeling Good gehören definitiv dazu. Die angestaubte Rumhängerfantasie versprüht einen gelassen-deliranten Glamour, und wenn Teile der Künstlerkommune nach oben, ins Freie ausweichen, schleicht sich gar ein märchenhaft-außerweltlicher Tonfall ein, der ein wenig an Ein Amerikaner in Paris (An American in Paris, 1951) erinnert: eine Märchenkulisse für romantisch verschrobene Freigeister über den Dächern von New York. Mittendrin die Hauptdarstellerin Mary Tyler Moore, vorher bekannt als Fernsehhausfrau, hier spielt sie ein von Freiheit eher schüchtern träumendes als sie auslebendes Mädchen mit einer backfischhaft (der Film verlangt nach einem solchen Vokabular) naiven, aber auch angstvollen Neugier auf Sex. In der beknacktesten, tollsten Szene des Films muss sie sich der Avancen eines vermeintlich deutschen Rumpelphilosophen mit falschem Bart und horny Funkeln in den Augen erwehren.
Dem Siegeszug des Lächelns muss Einhalt geboten werden
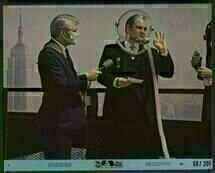
Jedenfalls ist der Film bereits einigermaßen crazy, bevor sein Clue ins Spiel kommt: What’s So Bad About Feeling Good handelt von einer Virenkatastrophe – und zwar von einer Epidemie des freundlichen Überschwangs. Ein verschmitzter, buntfedriger Vogel, ein Tukan, hat die Krankheit ins Land gebracht, auf einem Schiff, dessen Besatzung nun, anstatt im Hafenviertel zu randalieren, fröhliche Volkstänze aufführt. Nun ist also gute Laune ganz buchstäblich ansteckend, die Infizierten geben ihre missmutigen Rüpeleien auf und begegnen ihren Mitmenschen hinfort nur noch mit einem prophylaktisch die gesamte Welt umarmenden Lächeln. Die Mächtigen in Industrie und Politik geraten in Panik: Glückliche Menschen, so die Instantanalyse, konsumieren weniger, vor allem weniger Alkohol und Zigaretten. Dem Siegeszug des Lächelns muss Einhalt geboten werden.
Ned-Flanders-happy-neighbors-Amerika der 1950er Jahre
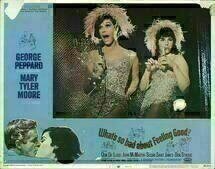
Auch die Kommunarden sind, einmal infiziert, nicht wiederzuerkennen. Sie sagen dem Weltschmerz Adieu, schneiden sich die lange Haare ab – und kaum zwei Minuten später sind sie drauf und dran, Familien zu gründen und in die Vorstadt zu ziehen. Eine fraglos satirisch gemeinte Pointe, die den Film freilich in die ideologische Nähe von Freddy Quinn („Wer will nicht mit Gammlern verwechselt werden? – WIR“) rückt. Dass eine objektiv von Verzicht und Verelendung gekennzeichnete Gegenkultur nicht das befreite Andere der kapitalistischen Moderne ist, sondern Unterdrückung und Selbstentfremdung lediglich mit anderen Mitteln und nicht unbedingt humaner auslebt, dürfte als Analyse kaum ganz falsch sein. Aber wenn als positives Gegenbild ausgerechnet das Ned-Flanders-happy-neighbors-Amerika der 1950er Jahre herhalten muss, dann ist das selbst im Rahmen eines (in Maßen) selbstironischen Lustspiels eine höchstens halbgare Auflösung gesellschaftlicher Widersprüche.
Dass What’s So Bad About Feeling Good einiges von seinem Charme verliert, sobald der Plot in Schwung kommt, hat jedoch weniger weltanschauliche als dramaturgische Gründe. Als Begleiterscheinung der Fröhlichkeit bricht eine unangenehme Hektik über den Film herein, der Schwerpunkt des Geschehens verlagert sich von der Künstlerkommune in die Einsatzzentrale des Krisenstabs, wo ein J. Edgar Hoover nachempfundener Regierungsvertreter installiert wird und hinfort hinter jeder Ecke eine kommunistische Verschwörung vermutet. Mary Tyler Moore muss derweil in einer missratenen Krankenhaus-Slapstick-Miniatur gleichzeitig eine Schwangerschaft vortäuschen und den aus eher unklaren Gründen immer noch plotrelevanten Tukan beschützen. Eine Virenkatastrophe ist, so scheint es, selbst unter utopisch invertierten Vorzeichen eine eher anstrengende Angelegenheit.
Neue Kritiken

Der große Wagen

Ella McCay

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

No Other Choice
Bilder zu „What's So Bad About Feeling Good?“




zur Galerie (7 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.
















