Weitermachen Sanssouci – Kritik
VoD: Nach seiner Kunstbetriebssatire Ich will mich nicht künstlich aufregen hat sich Max Linz nun der akademischen Welt angenommen. In Weitermachen Sanssouci kämpft sich der Lehrstuhl für Kybernetik, mit Drittmittelanträgen und Virtual-Reality-Brillen bewaffnet, in Richtung eines Endgegners namens Re-Evaluierung.

In seiner denkbar profansten Szene findet dieser Film sein treffendstes Bild. Klimaforscherin Phoebe Phaidon (Sarah Ralfs) unterhält sich mit einer Bürokollegin über Anträge, da kommt der Institutshausmeister, um eine Glühbirne auszutauschen. Als ihm die niedrigen Temperaturen im Büro auffallen, erklärt ihm Phoebe, sie habe schon den ganzen Tag an der Heizung herumgedreht, es werde einfach nicht wärmer. Woraufhin ihr der Typ erstmal mansplaint, was es mit dem Begriff Thermostat auf sich hat. Und dass sie ja nur das Gerät an der Tür auf die richtige Temperatur einzustellen brauche, die Heizungen würden dann Soll- und Ist-Zustand vergleichen und die Raumwärme entsprechend regulieren. Was er selbst nicht verstanden hat: Diese Lösung ist das Problem.
Alles für die erfolgreiche Re-Evaluation

Denn darum geht es in Weitermachen Sanssouci: Die Uni ist ein kalter Ort, gerade weil sich hier nichts mehr aufdrehen, gerade weil sich hier nur noch nachjustieren lässt und die Ziele bezifferbar sein müssen. Herzlich willkommen am Lehrstuhl für Kybernetik, wo Phoebe gerade ihre 26%-Stelle bei Professorin Brenda Berger (Sophie Rois) angetreten und deren Kurs „Einführung in die Simulationsforschung“ übernommen hat. Hier forscht außerdem Kollege Julius Kelp (Philipp Hauß) in einem quadratischen Raum mit Bluescreen-Wänden und einer riesigen Erdkugel an einem Drittmittelprojekt zur virtuellen Simulation des Klimawandels, während Stiftungsprofessor Alfons Abstract-Wege das verhaltensökonomische Konzept des Nudging am Mensakonsum der Studierenden ausprobiert. Jeder für sich will weiterkommen, alle zusammen müssen sie sich auf die anstehende Re-Evaluation des Lehrstuhls durch die Hochschulleitung vorbereiten, für die extra ein Motivationscoach (Maryam Zaree) eingestellt wurde. Würde nicht ein Image-Film helfen? Oder gleich eine Virtual-Reality-Show, in der das Lehrstuhlteam als Hologramm auftritt, dann würden schließlich Inhalt und Form der Selbstdarstellung zusammenfallen.
It’s funny cause it’s true

Max Linz hat sich nach Ich will mich nicht künstlich aufregen, seiner Satire auf den Kulturbetrieb, nun der deutschen Universität angenommen, sein bekanntes Waffenarsenal versammelt und losgeballert. Vieles ist ähnlich: die Stilbrüche, das anti-naturalistische Schauspiel, die Überführung institutioneller Rituale in absurdes Theater. Überhaupt macht der Film am meisten Spaß, wenn er mit feiner Beobachtungsgabe akademische Absurditäten seziert und einen „It’s funny cause it’s true“-Moment an den anderen reiht. Der Kurztrip auf eine Konferenz in Danzig namens „Utopia“; der obligatorische Sektempfang nach der Keynote, bei der man so lange nett zu wirken hat, wie man noch netzuworken hat; die berlinernde Sekretärin, die sich einen Smalltalkphrasenpanzer zugelegt hat, um die Tristesse überhaupt auszuhalten; das erste Plenum der Studis nach der Bibliotheksbesetzung, das durch den Auftritt der ersten Autoritätsperson beendet ist. Neben diesen kleinen Details finden sich verdiente zuspitzende Ausbrüche ein, etwa als ein vollkommen nichtssagender Vortrag mit einem Studierendenchor aus den letzten Reihen beantwortet wird, der ein bekanntes Kirchenlied als gesungenes Dankeschön für den Erkenntnisgewinn uminterpretiert.
Alte Hüte, leichte Ziele?
Natürlich werden hier auch alte Hüte neu anprobiert und leichte Ziele getroffen, wird zu den Bekehrten gepredigt und sich im Kreis gedreht. Was ließe sich auch leichter lächerlich machen als universitäre Vorträge mit fancy Titeln und wenig Substanz, wofür fänden sich mehr originelle Beispiele als für die Ökonomisierung von Bildung und anderen vormaligen Gemeingütern, was ist besser durch den Kakao zu ziehen als Managementsprache und Coaching, welche Begriffe rufen stärkere Abwehrreaktionen hervor als Drittmittelantrag und Evaluierungsphase? Und wer würde nicht zum Kulturpessimisten, wenn er den altehrwürdigen Royal Palast am Ku’damm mit dem Saturn in Beziehung setzt, der nun am gleichen Platz steht? So denkt man zwar manchmal nur schonklar und harhar. Dann aber wieder übersetzt Linz seine Kernthese – dass die deutsche Universität längst kein Elfenbeinturm mehr ist, sondern eine virtuelle Realität, ein kybernetisches System, das kein Außen mehr kennt und nur mehr um Selbsterhalt bemüht ist – in so knackige Dialoge und komische Situationen, dass es eine Freude ist. Und seinen Plot lässt er überall hin fliehen, bekommt ihn aber dennoch immer wieder in Richtung des großen Showdowns Evaluierung gebogen.
Fragen und Antworten
In gewisser Hinsicht ist Weitermachen Sanssouci also ein Schlaumeier-Film, und vielleicht muss er das sein, wenn er sich denkend dem Elend unserer Denkfabriken nähert. Zynisch ist er aber nie, eher ernsthaft besorgt. Am Ende singen ein paar Studis ganz melancholisch die deutlichsten Zeilen: „Warum kann es hier nicht schön sein? Und warum werden wir nicht froh?“ Präziser noch wunderte sich am Anfang Lehrstuhlinhaberin Berger während Phoebes Einstellungsgespräch über die vielen „jungen, schlauen Menschen, von denen ich mich dauernd frage, warum sie nichts gegen ihre Situation unternehmen.“ Doch der Satz fällt eben nicht im Dialog, sondern bleibt im Off, die Erzählerstimme dieses Films gehört nämlich ausgerechnet einer jener irgendwie linksintellektuellen professoralen Gestalten, die trotz Einsicht in die Falschheit des Ganzen irgendwie den eigenen Laden und damit das Ganze am Laufen halten müssen. So bleiben die Fragen stecken zwischen choralem Klagelied und der Vereinzelung des Voice-over.
Und Antworten? Und Protest? Und Revolte? Die Bibliothek ist irgendwann geräumt, das Promotionsprojekt von Phoebes Mitbewohner zur Erforschung der Biokybernetik im sozialistischen Chile wird überall abgelehnt. Für eine revolutionären Horizont mit Chancen auf erfolgreiche Evaluierung müsste wohl noch einiges an Drittmitteln angeworben werden. Und wer stellt überhaupt den richtigen Soll-Wert ein?
Der Film steht bis zum 28.05.2021 in der RBB-Mediathek.
Neue Kritiken

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother

The Day She Returns

Prénoms
Trailer zu „Weitermachen Sanssouci“

Trailer ansehen (1)
Bilder

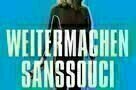


zur Galerie (6 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.













