Vortex – Kritik
VoD: Gaspar Noé begleitet ein altes Ehepaar auf dem letzten Weg. In seinem bislang reifsten Werk Vortex schafft er beklemmende Bilder des Kontroll- und Selbstverlusts, in denen sich die beiden Protagonisten aufzulösen scheinen.

Eine Szene des Glücks lässt Noé den beiden: Ganz am Anfang stehen der Mann (Giallo-Legende Dario Argento) und die Frau (Françoise Lebrun) in zwei gegenüberliegenden Fensterrahmen ihrer gemeinsamen Wohnung und blicken einander an. „Es ist angerichtet“, sagt sie – und schon laufen beide los, treffen ein paar Meter weiter im Wohnzimmer aufeinander und gehen zusammen auf ihren von Blumen bewachsenen Balkon, um zu frühstücken. „Das Leben ist ein Traum, oder?“, fragt sie – er bejaht. Dann stoßen sie an: „Auf uns!“, ehe die Kamera wegschwenkt. Es ist der einzige glückliche Moment in Vortex (2021) – und vielleicht der finale für das alte Ehepaar, das der Film auf dem letzten Weg begleitet.
Dass die restlichen 130 Minuten ein bedrückender Blick in den Strudel des endenden Lebens sein werden, ahnt man zu diesem Zeitpunkt bereits, denn Noé widmet den Film gleich zu Beginn „all jenen, deren Hirn sich früher zersetzt als ihr Herz“. Er spielt außerdem als Prolog Françoise Hardys Musikvideo zum tieftraurigen Chanson Mon amie la rose ein – und er schreibt in den vorangestellten Credits zu jedem Namen das jeweilige Geburtsjahr („Gaspar 1963“), quasi den Startschuss für das Hinlaufen zum Tode.
Beklemmung im Splitscreen

Was man so früh indes noch nicht ahnt, ist, dass es sich bei Vortex um Gaspar Noés reifstes Werk handelt. Dem sonst vor allem für Exzesse aus Sex (Irreversibel, 2002), Gewalt (Menschenfeind, Seul contre tous, 1998), Drogen (Enter the Void, 2009) und experimentellen Stilmitteln (Lux Æterna, 2019) bekannten Regisseur gelingt hier über die gesamte Laufzeit eine beeindruckende Zurückhaltung. Es ist nichts spektakulär, reißerisch oder provokant in Vortex. Noé sieht in beinahe sozialrealistischer Manier zwei Menschen beim Sterben zu und verzichtet dabei sogar auf Momente des Ekels oder der Demütigung, wie sie in Michael Hanekes thematisch ähnlichem Film Liebe (Amour, 2012) zu finden sind.
Noé hat das auch gar nicht nötig. Er nimmt uns einfach in langen, mitunter in Echtzeit ablaufenden Passagen mit auf die Stationen des Abschieds. Da fast der gesamte Film in zwei Splitscreen-Frames aufgeteilt ist, sehen wir dabei anfangs vor allem Kontraste: Hier der Mann, der sich morgens sofort an die Schreibmaschine setzt, um sein Buch über das Zusammenspiel von Filmen und Träumen fertigzustellen, das – wie er jedem, der zuhört, immer wieder versichert – von großer Bedeutung ist. Dort die unter Demenz leidende Frau, die zunehmend orientierungslos mit wildem Blick durch ein Geschäft oder die eigene Wohnung irrt, nichts mit sich anzufangen weiß und sich jetzt schon nicht mehr erinnern kann, was sie vor einer Minute tun wollte. Es sind beklemmende Bilder des Kontroll- und Selbstverlusts, in denen sich die beiden Protagonisten schon fast aufzulösen scheinen, da Kameramann Benoît Debie ihre Körper und die Wohnung in unterbeleuchtete Düsternis hüllt.
Stille statt Beethoven
Später kommt der Sohn (Alex Lutz) dazu, will helfen, muss plötzlich die Elternrolle für seine Eltern übernehmen, will sie zum Umzug in ein Heim und damit zur radikalen Einschränkung jeglichen unabhängigen Lebens überreden. Doch seine Mutter kann kaum noch einen vollständigen Satz sprechen, und sein Vater weigert sich, den Ernst der Lage anzuerkennen.
In manchen stilistischen Elementen fügt sich Vortex durchaus ins Kontinuum des bisheriges Œuvres Noés: Die Kamera blinzelt ab und an, die Montage verstößt gelegentlich gegen etablierte Schnittregeln, und die Trennlinie zwischen den zwei Screenhälften durchschneidet manchmal Figuren oder teilt ein- und dieselbe Handlung in zwei Bildkader auf. Doch die große Differenz zu Noés vorherigen Filmen stellt besonders das Ende unter Beweis: In Standbildern sehen wir, wie die Wohnung ausgeräumt wird, in der die beiden Jahrzehnte miteinander verbracht haben. Früher hätte Noé da wohl Beethoven und eine markige These über den Zyklus und die Bedeutungslosigkeit des Lebens druntergeknallt. Heute schreibt er einfach in würdevoller Stille „Fin“.
Der Film steht bis 12.07.2025 in der Arte-Mediathek.
Neue Kritiken

Primate

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail
Bilder zu „Vortex“

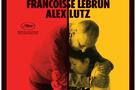


zur Galerie (5 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.















