Virus – Kritik
Das Virus als Brandbeschleuniger des Kalten Krieges: Kinji Fukasakus Seuchenblockbuster irrlichtert zwischen Utopie und Totalresignation. Zuletzt setzt er im ewigen Eis die Geschlechterverhältnisse auf null.

Die Krankheit, die einen Großteil der Menschheit auslöscht, trägt ausgerechnet den Namen „Italian Flu“. Freilich ist diese genauso wenig italienisch wie das Coronavirus chinesisch. Die Eskalationsmontagen, die Kinji Fukasakus Virus (1980) vor allem in der ersten Dreiviertelstunde prägen, überspringen Länder- und Sprachgrenzen mit derselben Leichtigkeit, die auch Viren über die Kontinente migrieren lässt. Auf epidemiologische Details verschwendet der Film allerdings ansonsten nur sehr wenige seiner 156 Minuten Laufzeit (von den für ausländische Märkte hergestellten gekürzten Fassungen ist, nebenbei bemerkt, unbedingt abzuraten). Ist das Virus einmal freigesetzt, scheint so ziemlich jede_r so ziemlich sofort betroffen zu sein, die Krankheit verläuft kurz und schmerzhaft, eine junge Frau reißt sich in der Disco die Kleider vom Leib und bricht zusammen, eine Ärztin, die im Badezimmer des Krankenhauses kollabiert, wird in emphatischer Großaufnahme zum ersten individuierten Opfer. Einmal doziert ein Wissenschaftler über die Gefahren des Virus und stellt sich dabei vor seine eigene Lichtbildpräsentation; das Schaubild, das den Infizierungsprozess darstellt, wird auf seinen eigenen Körper projiziert. Damit ist die Sache klar: Letztlich ist der Kamerablick selbst Patient null, und wir sind alle Gezeichnete. Zuverlässigen Schutz bietet einzig – das ist die Schutzzone, in der sich die Dramaturgie entfalten kann – extreme Kälte: Ab zehn Grad unter null bleibt das Virus inaktiv.
Agent welthistorischer Dialektik

Bei Fukasaku ist das Virus in erster Linie ein Phänomen der Geopolitik. Genauer gesagt entspringt es dem Kalten Krieg, zu dem es allerdings kein statisches, sondern ein bewegliches Verhältnis pflegt: Zunächst, beim Ausbruch der Krankheit, erscheint es lediglich als ein zufälliges Beiprodukt des schon seit Jahrzehnten laufenden Rüstungswettkampfs. Wenn sich, bald darauf, die Ausmaße der Katastrophe zu offenbaren beginnen, wird es zu einem Brandbeschleuniger, der die kalte Schattendiplomatie in den heißen Tod überführt. Aber noch einmal ein paar Monate später zeigt sich, dass die unsichtbare Gefahr die Dynamik des Kalten Kriegs nicht nur erfüllt, sondern auch aufgehoben hat – die radikal reduzierte Rumpfmenschheit, die auf einer antarktischen Forschungsstation überlebt hat, scheint die politischen Antagonismen einigermaßen überwunden zu haben. Das Virus als Agent welthistorischer Dialektik; ein Ansatz, der freilich im letzten Filmdrittel verkompliziert wird: Der Kalte Krieg kehrt wieder zurück, sozusagen hinter dem Rücken der Menschheit, als antagonistischer Kurzschluss von Waffensystemen, die, um ihre todbringende Kraft zu entfalten, überhaupt keiner menschlichen Subjektivität mehr bedürfen. Dem historischen Materialismus wird, qua posthumanistischer Verselbstständigung von Technik, der Boden unter den Füßen weggezogen.

Eine originelle, finster-sardonische Wendung, wie der Film überhaupt ausgesprochen düster geraten ist, gerade angesichts seiner epischen Ausmaße – im Jahr seiner Produktion war der weitgehend in englischer Sprache produzierte Virus der teuerste japanische Film aller Zeiten. Vorbild waren offensichtlich zumindest auch die hochbudgetierten Hollywood-Katastrophenfilme der 1970er, dafür spricht schon das Casting von Veteranen des Genres wie George Kennedy oder Robert Vaughn. Aber wo amerikanische Beiträge zum Genre stets stabil auf der Seite der Überlebenden stehen, nimmt Fukasaku zumindest in einigen Schlüsselmomenten die Perspektive des Todes ein: besonders eindringlich in einer Szene, in der die letzten Menschen das Funksignal eines Jungen aufnehmen, der nach Hilfe ruft, aber, weil er das Funkgerät nicht richtig zu bedienen versteht, verzweifelt und sich das Leben nimmt. Aufnahmen brennender Leichenberge und grinsender Skelette wiederum machen deutlich, dass das Virus nicht nur eine Chiffre für den Kalten Krieg ist, sondern die gesamten Katastrophen des 20. Jahrhunderts mitbezeichnet, vor allem natürlich jene, die vom Produktionsland Japan miterlebt und mitverschuldet wurden.
A new approach to human sexuality

Dennoch sind im Moment des Zusammenbruchs erst einmal die Russen und vor allem die Amerikaner die politischen Aktivkräfte. Ein Handlungsstrang spielt direkt im Oval Office. Während seine Berater einer nach dem anderen erst durchdrehen und dann sterben, hält der Präsident, gespielt von Glenn Ford, in seinem zunehmend verwahrlosten Büro die Stellung, bis ihn schließlich die letzte Abendsonne des alten, sterbenden Amerika umflort: twilight’s last gleaming. An den japanischen Figuren, besonders an dem empfindsamen, leicht verschrobenen Arzt Shûzô Yoshizumi (Masao Kusakari), kristallisieren sich hingegen die affektiven, intimen Folgen der Katastrophe. Schon früh im Film dringt ins Dauerfeuer der globalen Virenexpansion die Großaufnahme einer Frau, die in die Kamera blickend versichert: „Ich bin nicht schwanger“. Ein Erinnerungsbild Shûzôs, allerdings eines, das, wie wir wissen und Shûzô ahnt, lügt. Seine Partnerin hatte ihm kurz vor seinem Aufbruch in die Antarktis ihre Schwangerschaft verschwiegen, weil sie sich von ihm vernachlässigt fühlte. Das private Drama, um dessen Auflösung das Virus ihn betrogen hat, kehrt als Phantasma zurück, wenn er in der norwegischen Polarstation die hochschwangere Marit (Olivia Hussey) findet.

Im ewigen Eis werden nicht zuletzt die Geschlechterverhältnisse auf null gesetzt. „We need a new approach to human sexuality“, weiß eine von nur acht Frauen, die gemeinsam mit gut 180 Männern das Überleben der Spezies sichern sollen. Die konkrete Ausgestaltung dieses „new approach“ bleibt zwar weitgehend (nicht allzu angenehme) Andeutung; aber das sonderbar zwischen Utopie und Totalresignation irrlichternde Koda des Films immerhin kann man doch, mit etwas gutem Willen, so verstehen, dass das Virus erst dann endgültig besiegt sein wird, wenn auch das Patriarchat seiner dialektischen Auflösung zugeführt ist.
In Deutschland ist der Film unter dem Titel Overkill - Durch die Hölle zur Ewigkeit in einer stark gekürtzen Fassung erschienen. Die ungeschnittene japanische Originalfassung ist in der public domain und kann hier angesehen werden.
Zur Einführung unserer Virenkino-Reihe geht es hier
Eine Übersicht mit Seuchenfilmen gibt es hier
Neue Kritiken

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho

Die Spalte
Trailer zu „Virus“
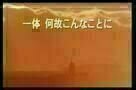
Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (23 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.


















