Der flüssige Spiegel – Kritik
In seinem Debütfilm um einen jungen Geist in Paris wandelt Stéphane Batut zwischen den Welten und sucht nach einer Brücke. Der flüssige Spiegel ist eine filmische Nahtoderfahrung, in der die Handkamera den Moment feiert und Totalen direkt ins Jenseits führen.

In Stéphane Batuts Der flüssige Spiegel stimmt die Chemie zwischen den Protagonisten. Was wie eine Plattitüde klingt, ist bereits als Metapher im französischen Originaltitel eingeschrieben: Vif-Argent, zu deutsch: Quecksilber. Batut scheint die chemischen Eigenschaften des Übergangsmetalls genau zu kennen: gefärbte Verbindungen, verschiedene Oxidationszustände, eine katalysatorische Wirkung und komplexe atomare Strukturen. All diese Fähigkeiten formen die Dramaturgie und die Fotografie seines Films: Architekturen und Landschaften werden symmetrisch-stabil dargestellt, Körper dagegen eher organisch und in ihrer emotionalen Zerbrechlichkeit eingefangen. In den Drohnenaufnahmen bewegen sich die Menschen als winzige Atome durch den öffentlichen Raum. Und dort, wo sich die beiden Protagonisten Juste und Agathe berühren, mischt sich das gleißende Blau einer Brückenbeleuchtung mit dem satten Orange einer Straßenlampe und tiefem Nachtschwarz. Überblendungen machen schließlich auch die unterschiedlichen Sphären der beiden Protagonisten sichtbar: Hier verschmelzen nicht nur Filmbilder miteinander, sondern zwei Körper aus unterschiedlichen Welten zu einer neuen Erfahrung.
Ein Toter unter den Lebenden

Der junge Juste ist nach seinem rätselhaften Tod als Geist zurück unter die Lebenden von Paris gekehrt. Er begreift diesen Zustand jedoch erst, als er Agathe kennenlernt. Eine zufällige Begegnung, die zunächst den Anschein einer Verwechslung macht, ihren Anfang jedoch bereits vor über zehn Jahren genommen hat – mit einem damals so abrupten wie unvorhergesehen Ende.

Meisterhaft verwebt Batut von Anfang an die unterschiedlichen Erfahrungswelten seiner Figuren, sodass die Aggregatzustände des Lebendigen und des Geisterhaften nie eindeutig voneinander zu trennen sind. Vielmehr ergibt sich ein Zwischenraum der Anziehungskraft. Als Zuschauer tastet man sich mit Agathe und Juste an die Realität von Der flüssige Spiegel und den Wahrheitswert der Bilder heran. Ist Juste nur eine Projektion aus Agathes rastloser Erinnerung? Ist die Liebe zu Agathe Justes ungeahnte Chance auf die Rückkehr ins Leben? Gibt es womöglich nicht nur eine materielle, sondern auch eine metaphysische Brücke, die den Widerspruch beider Daseinsformen überwindet, eine Ebene jenseits von Leben und Tod, auf der sie zueinanderfinden können?
Der Blick in den Spiegel

Die Verknüpfung des Wahren mit dem Sichtbaren löst Der flüssige Spiegel konsequent auf. Juste ist als Geist für alle Lebenden unsichtbar, nur Agathe und jene verstorbenen Seelen, die er im Auftrag der Ärztin Dr. Kramarz auf ihren letzten Weg geleitet, können ihn sehen. Jedoch ist diese exklusive Sichtbarkeit fragil, denn als Juste seiner Aufgabe als Fährmann ins Jenseits nicht gewissenhaft nachkommt, wird er auch für Agathe unsichtbar – und auf diese Weise mit seiner größten Angst konfrontiert.

In der Unsicherheit seiner Protagonisten gelingt es Batut, eine Brücke zum Publikum zu schlagen und eine universelle Angst zu adressieren: die Angst vor der Anonymität und dem Alleinsein. „Nobody knows who I am“, läuft der Soundtrack im Hintergrund, als sich Juste und Agathe im Park Butte Chaumont das erste Mal tanzend näherkommen. Immer wieder sucht Juste sein Spiegelbild und muss dabei schmerzlich feststellen, dass er sich nicht in die Augen sehen kann, sondern nur von hinten erkennt. Justes Blick in den Spiegel ist ein Blick zurück, eine Suche nach der Person, die er war – und die er nur dadurch, dass Agathe ihn erkannt hat, selbst zu erkennen vermag.
Der Weg führt durch die Erinnerung

Überhaupt, die Zeit: Der flüssige Spiegel erzählt die Gegenwart, die Agathe und Juste in der Vergangenheit versäumt haben und die sie nun erleben, in Nahaufnahmen und Close-ups von Körperteilen und Blicken. Er fängt Berührungen und Gesten in sinnlichen handgeführten Kamerafahrten ein. Diese Lebendigkeit des Moments kontrastiert Batut mit dem Übergang ins Jenseits. Die Verstorbenen, die Juste dorthin begleitet, schreiten an ihrer prägendsten Erinnerung vorbei. Diese Passagen sind Totalen: Ein Urwald, eine Schneelandschaft und eine Küste werden zu begehbaren Tableaus, die wie ein Bühnenbild in einem letzten Akt durchquert werden.
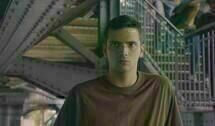
Der flüssige Spiegel ist als Gesamtkomposition komplex, doch Batut übertreibt es nicht mit der Stilisierung. Gerade durch die Reduktion auf das Wesentliche ist der Film so eindringlich und feinfühlig, erzählt mehr als das, was er zeigt. Gleich einer filmischen Nahtoderfahrung spiegelt er das Leben mit dem Tod und umgekehrt – und löst dabei die Realitäten fließend ineinander auf.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Der flüssige Spiegel“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (14 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.













