Unsere Zeit wird kommen – Kritik
Berlinale 2025 – Forum: Das komplizierte Gemisch aus Abhängigkeiten und Eigenbedürfnissen. Wie die gemeinsame oder fremde Sprache Körper verändern kann. Mit filmischer Anteilnahme porträtiert Ivette Löcker die problembeladene Beziehung eines österreichisch-gambianischen Liebespaars.

Da waren diese Typen, sagt Siaka, die kamen eines Abends zu ihm an den Tisch und fingen an, auf ihn einzuschlagen. Zwei Mädchen versuchten dazwischenzugehen, konnten die Typen aber nur mühsam aufhalten,und als dann die Polizei kam, war die auch keine Hilfe: Die Polizisten drückten Siaka mit dem Gesicht auf die Tischplatte und wollten ihn festnehmen. Dass er lediglich attackiert wurde, interessierte sie nicht; sie nahmen an, die Männer hätten miteinander gekämpft,
Als Siaka dies zu Beginn von Unsere Zeit wird kommen erzählt, lässt sich hinter ihm eine Bar erkennen; es ist anzunehmen, dass sie der Ort ist, an dem sich die Geschichte ereignete. Während die Art, wie er spricht, an Dringlichkeit und Intensität gewinnt, bewegt sich die Kamera immer näher an sein Gesicht, lässt den Hintergrund verschwinden und fokussiert sich auf ihn und seine Worte.
Siaka ist ein Flüchtling aus Gambia, der in Wien lebt und mit Victoria, einer Österreicherin, verheiratet ist. Lange Zeit war er in Österreich ohne Papiere. Mit unsicherem Duldungsstatus erlebte er dabei verschiedene Arten gewalttätigen und allzu alltäglichen Rassismus: „This life doesn’t favour me.“ Victoria leidet mit und fühlt sich überfordert. Unter Tränen liest sie ihm aus ihrem Tagebuch vor, wie ihr gelegentlich der Gedanke komme, wieder ein normales Leben führen zu wollen und nach der Arbeit nichts anderes mehr im Kopf zu haben, als sich vor den Fernseher zu setzen. Aber „normal“, sagt sie, hätte sie früher ja eigentlich nie leben wollen.
Verletzungen und Überforderungen

So ist man bereits in der zweiten Szene von Unsere Zeit wird kommen mittendrin in jenem komplizierten Gemisch aus Abhängigkeiten und Eigenbedürfnissen, das sich Paarbeziehung nennt und das die Regisseurin Ivette Löcker auch schon in früheren dokumentarischen Arbeiten anhand von so intensiven wie intimen Porträts beobachtet hat: Sei es ein Matrosenpärchen, das sich auf dem im Sommer aufgetauten Baikalsee mit Schiffstransporten sprichwörtlich über Wasser hält (Marina und Sascha, Kohleschiffer, 2008) oder zwei Mittdreißigern in Sankt Petersburg, denen die gemeinsame Heroinsucht einen fragilen Zusammenhalt schenkt (Wenn es blendet, öffne die Augen, 2014).
Unterschiedlichen Erfahrungen liegen oftmals verbindende Ursprünge zugrunde. Sprechen Victoria und Siaka über ihre Familien, teilen sie Verletzungen und Überforderungen miteinander. Er erzählt, wie er den Anforderungen seiner Familienmitglieder in Gambia oftmals nicht gewachsen ist, bisweilen den Kontakt zu ihnen unterbrechen möchte, damit er ihre niederschmetternd prekären Probleme nicht den ganzen Tag in seinen Gedanken mit sich führen müsse. Sie erzählt ihm wiederum, wie die Kommunikationsprobleme zwischen ihren Eltern sie als Jugendliche in eine schwerwiegende Depression getrieben hätten.
Die Familie als potenzieller Hort des Rückhalts und der Geborgenheit, aber auch als Keimzelle psychischer Krankheiten und Blessuren, die lange anhalten können: Darüber drehte Löcker bereits 2017 mit „Was uns bindet“ einen Film. Sie porträtiert darin ihre eigene Eltern, die zum Zeitpunkt der Aufnahmen rund 20 Jahren geschieden sind, aber dennoch weiterhin gemeinsam im gleichen Haus wohnen – als Zweckgemeinschaft, die sich mehr schlecht als recht die beiden Geschosse des Hauses aufzuteilen versucht. Ihre Beziehung prägt auch ihre Kinder und damit die Regisseurin . Wie sie sich selbst in den Film einbringt, zeugt von einem undogmatischen Verhältnis zur dokumentarischen Praxis , das sich auch in ihren anderen Filmen ausdrückt: Anstelle von scheinobjektiver Illusion oder aufdringlicher Ichbezogenheit wahrt sie eine involvierte Zurückhaltung.
Wie sich miteinander reden lässt

Auch in Unsere Zeit wird kommen hört man, da ist rund die Hälfte des Films bereits vergangen, einmal Löckers Stimme aus dem Off. Siaka und Victoria unterhalten sich über all das, was sie aus ihrem Leben in den Film hineinlassen wollen. Sie wirft ihm vor, er würde sich vor der Kamera lediglich auf die schlechten Erfahrungen konzentrieren, kaum über schöne Momente sprechen wollen, er entgegnet, sie tue sich schwer damit zu akzeptieren, dass in seinem Leben eine allumfassende Traurigkeit dominiere, die sich über alles lege. Die Regisseurin schaltet sich ein: Ich glaube, euer Zusammensein ist davon geprägt, dass zum einen die Vergangenheit immer auch präsent bleibt, ihr andererseits aber permanent auf der Suche danach seid, neue Wege zu finden, wie ihr gut miteinander reden könnt.
Wie sich miteinander reden lässt, ist in Unsere Zeit wird kommen auch eine Frage der geteilten wie trennenden Sprache. Zusammen verständigen sich Victoria und Siaka mit Englisch, einer Sprache, die beide ähnlich gut beherrschen und die somit kein kommunikatives Ungleichgewicht erzeugt. Auf der Arbeit oder bei Behörden ist Siaka auf Deutsch angewiesen, mit dem er sich weniger präzise ausdrücken kann. In Gambia spricht er Mandinka mit einer nonchalanten Gelöstheit, die nicht nur in der Stimme erkennbar wird, sondern den ganzen Körper ergreift, die Anspannung vertreibt.
Diese Veränderungen einzufangen, Menschen dabei zu beobachten, wie sie miteinander reden, Einstellungen zu finden, die abbilden, wie sie sich körperlich zueinander verhalten, während sie sprechen: Ivette Löcker gelingt das in Unsere Zeit wird kommen aufs Neue. Ihr dokumentarisches Kino ist Ausdruck einer großen, so filmischen wie empathischen Anteilnahme.
Neue Kritiken

Crocodile

Auslandsreise

AnyMart

Allegro Pastell
Trailer zu „Unsere Zeit wird kommen“

Trailer ansehen (1)
Bilder



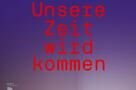
zur Galerie (4 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.










