Typhoon Club – Kritik
Neu auf Mubi: Die mathematische Ordnung der Erwachsenen und der jugendliche Überschuss der Pubertät. Shinji Sōmais mäandernder Typhoon Club (1985) folgt über 5 Tage einer Gruppe Schüler*innen. Und ein Sturm wird kommen, der gleichermaßen Freiheit wie Grausamkeit mit sich bringt.

Der Schulweg von Mikami und Rei führt an Betonbauten und Strommasten vorbei. Verkehrsschilder mit Park- und Einfahrverboten stehen wie Vogelscheuchen am Straßenrand. In der Schule sitzt dann jede*r an einem einzelnen Tisch, es wird der Satz des Pythagoras gelehrt. A²+B²=C², die vernünftige Welt der Erwachsenen gibt Ordnung vor. Draußen begrenzen Hügel den Horizont des kleinen Städtchens nahe Tokio.
Mikami und Rei, die Haare adäquat gekämmt oder geflochten, weißes Hemd, schwarzes Beinkleid, sind zwei einer Handvoll pubertierender Schüler*innen, deren Leben der knapp 40 Jahre alte Film Typhoon Club von Shinji Sōmai in Schlaglichtern be- und erleuchtet. Am Himmel der Stadt aber zieht ein Taifun auf, der die Welt der Heranwachsenden durcheinanderwirbeln wird.
Alltag und Grenzerfahrung

Bis dahin dauert es jedoch eine Weile. Knapp eine Stunde seiner Laufzeit verbringt der Film mit dem Vorspiel, einer Aneinanderreihung lose kombinierter Momente aus den Leben seiner Figuren. Und anders als im Mathematikunterricht ergeben eins und eins hier nicht unbedingt zwei. Es bleibt ein Überschuss – das Leben der Jugendlichen blitzt in Details auf, erklärt sich aber nicht durch deren Addition. Immer ist da ein Bewusstsein für die Kontingenz der Ereignisse, für das Vorher und Nachher zu spüren. Szenen, ja ganze Handlungsstränge brechen abrupt ab, zerfasern. Es könnte auch anders sein.
Typhoon Club ist ein mäandernder Film, der lineare Abläufe unterminiert, der weder Start- noch Endpunkt klar fixiert, der wie seine Figuren in der Schwebe verweilt. Die Pubertät wird nicht als Zeitstrahl gezeichnet, der von A nach B führt, vielmehr verdichten sich in den fünf geschilderten Tagen einzelne Momente zu Wegweisern, das Alltägliche steht hier neben der Grenzerfahrung –gleich zu Beginn stirbt eine Figur fast, es hätte auch anders kommen können.

Die Verkehrsschilder vom Anfang verweisen bereits auf diese Möglichkeitsräume, auf die Unbestimmbarkeit der Abläufe. Denn die Wege, denen zu folgen lohnt, sind noch nicht gebaut. Positive Vorbilder höheren Alters fehlen in der Welt dieses Films, wie Erwachsene sowieso primär durch Abwesenheit auffallen. Einzig Klassenlehrer Herr Umemiya, ein Mann mit autoritären Anflügen, bietet sich als möglicher Zukunftsentwurf an – seinen Weg möchte man jedoch nicht einschlagen, er ist unbefahrbar geworden, unbrauchbar. Wie es sonst weitergehen soll, ist unklar, die Zukunft hängt noch in den Wolken. Bis zur Ankunft wird geträumt, nachgedacht, geprobt. „Das Fliegen verlernt hat das Huhn nicht als Ei, sondern als Huhn“, sagt Mikami einmal – Erwachsenwerden ist in Typhoon Club ein Moment der Gefahren und Potenziale gleichermaßen.
Auch der Tod rückt näher

Sōmai handelt formal gewissermaßen im Geiste seiner jungen Figuren, weil er sie im Bild meist von den Erwachsenen isoliert. Selbst im Klassenzimmer, wo die beiden Parteien nur wenige Meter trennt, spaltet die Kamera die Generationen. Ist der Lehrer im Bild zu sehen, fehlen die Jungen, und andersherum. Nur im Ausnahmezustand, bei einer ausbrechenden Schlägerei etwa, vermischen sich die beiden Welten für einen Moment, bevor ein Schnitt oder eine Kamerafahrt sie eilig wieder trennt, als wäre gerade etwas Unanständiges passiert.
Dabei bleibt die Kamera stets distanziert, Nahaufnahmen fehlen in Typhoon Club gänzlich. Wie Gemälde sind viele seiner Einstellungen aufgebaut, die Figuren bilden genaue Gefüge, die sich wandeln, zu neuen Formen zusammensetzen. Mögen in der Erzählung einzelne Figuren wichtiger sein als andere, präsentiert der Film doch eine Gruppe, in der jede*r einen Platz einnimmt.

Ausbruchsversuche aus diesen zu Beginn oft starren Gebilden häufen sich, als der Taifun eintrifft und die Jugendlichen endgültig ohne Aufsicht in der Schule isoliert. Aus einem Vibrieren werden Erschütterungen, Begehren und Ängste entladen sich in Gewalt und Tanz, auch der Tod rückt näher. Der Exzess mündet mal in unumkehrbarer Grausamkeit, mal in kurzen Momenten der Freiheit. Am Ende, nach dem Taifun, ist Raum gewonnen – „nicht um der Trümmer, sondern um des Weges willen, der sich durch sie hindurchzieht.“ (Walter Benjamin)
Den Film kann man bei Mubi streamen.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Typhoon Club“

Trailer ansehen (1)
Bilder

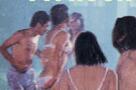


zur Galerie (9 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Yannic
Shinji Sōmai fliegt gerne unter dem Radar. Alle Filme, die ich von ihm kenne sind hervorragend. Es freut mich sehr, dass er auf einigen Leinwänden zu sehen sein wird.












1 Kommentar