Things We lost in the Fire - Eine neue Chance – Kritik
Die dänische Regisseurin Susanne Bier hat zwischen Dogma 95 und Hollywood einen weiten Weg zurückgelegt, ist jedoch auch bei ihrer ersten US-Produktion der eigenen Handschrift treu geblieben.

Susanne Bier und ihr Markenzeichen, lange Großaufnahmen von Gesichtern, dürften wie ein Geschenk für Hollywoods Schauspielerelite sein. Selten wird jede einzelne Regung der Mimik so genau und ausdauernd beobachtet wie in den Filmen der dänischen Regisseurin. In Open Hearts (Elsker dig for evigt, 2002), Brothers (Brødre, 2004) und auch zuletzt in Nach der Hochzeit (Efter brylluppet, 2006) ist die unruhige Kamera immer auf der Suche nach Gefühlsregungen. So auch in Things We Lost in the Fire, nur dass dieses Mal die weltweit bekannten Gesichter von Benicio del Toro und Halle Berry zu sehen sind. Die beiden spielen zwei sehr unterschiedliche Menschen, denen man das Zentrum ihres Lebens genommen hat. Dass diese Art von Kino seinen Ursprung nicht in der amerikanischen Tradition der empathischen Psychologisierung hat, sondern in der dänischen Dogma-Bewegung, verwundert nur auf den ersten Blick.
Wenn jemand wie Susanne Bier also dem Ruf nach Hollywood folgt, könnte daraus schnell ein Schauspieler-Drama werden, mit viel Psychologie und Zeigen-was-man-kann, eine Visitenkarte der Stars für die nächste Oscarverleihung. Ein schon oft gesehenes emotionales Malen nach Zahlen. Mit ihrem US-Debüt Things We Lost in the Fire ist das glücklicherweise nicht passiert. Der Film ordnet sich dem Star-System nicht unter. Biers Regie bleibt ihren europäischen Arthouse-Wurzeln treu, die Handschrift der Regisseurin bestimmt jede Szene, und die betont eben nicht die – hier durchweg großartigen – einzelnen mimischen Leistungen, sondern das komplizierte emotionale Geflecht zwischen schicksalsgeplagten Menschen.

Szenen beginnen oft nicht, wie üblich, mit einer Übersicht, sondern mit einem Detail. Zuerst sieht man, in Großaufnahme, wie Kaffee aus einer Kanne in eine Tasse fließt. Erst dann folgt der Schnitt zur Frühstückssituation. Die Kamera schweift ab, hat Zeit für Nebensächlichkeiten und Details. Die Bilder von Kameramann Tom Stern, mit dem Bier zum ersten Mal zusammenarbeitet, verweilen lange auf Augenpartien und Händen. Das Bild zittert leicht, die Unruhe der Protagonisten überträgt sich auf den Zuschauer. Genauso hat Morten Søborg für die Regisseurin deren dänische Produktionen gedreht. Man schließt vom Speziellen aufs Allgemeine, nicht umgekehrt. So wie Biers Filme keine Botschaften sein wollen, auf die man von erhöhter Position herabblicken kann, so ist auch ihre Herangehensweise an die Geschichten. Man ist als Zuschauer viel zu nah dran, der Blick ist zu verengt auf Details, als dass man aus dem Gesehenen das Offensichtliche ableiten könnte. Die Schicksale sind keine Bebilderungen von Thesen, sondern stehen zunächst einmal nur für sich selbst.
Auch der Drehbuchautor ist neu. Nach der langjährigen Zusammenarbeit mit Anders Thomas Jensen hat Bier dieses Mal ein Skript des Neulings Allan Loeb verfilmt, das aber wesentliche Elemente der früheren Geschichten aufweist. Am größten ist die Nähe zu Brothers, in dem ebenfalls einer Familie mit dem Ehemann und Vater das Zentrum abhanden kommt. In dem älteren Film ist es der kleinkriminelle Bruder des Vermissten, der die Leerstelle zu füllen versucht. In Things We Lost in the Fire ist es der drogenabhängige Freund des toten Ehemannes.
Audrey (Halle Berry) und Brian (David Duchovny) führen eine Bilderbuch-Ehe mit zwei wohlerzogenen Kindern und einem wunderschönen Haus. Jerry (Benicio del Toro) ist ein in der Gosse gelandeter Ex-Anwalt, dem Brian als einziger Freund geblieben ist. Als Brian auf offener Straße erschossen wird, während er versucht, eine Frau vor ihrem gewalttätigen Ehemann zu schützen, verlieren sowohl Audrey als auch Jerry den wichtigsten Menschen ihres Lebens. Die privilegierte Hausfrau und Mutter und der Junkie nähern sich an und suchen gegenseitigen Trost, schließlich lädt Audrey Jerry ein, bei ihr einzuziehen.

Nein, daraus wird keine Liebesbeziehung. Wir sind zwar in Hollywood, aber immer noch in einem Film von Susanne Bier, die auch hier Hoffnungen und Enttäuschungen mitleidlos aufeinander prallen lässt. Es geht auch nicht um Liebe zwischen den beiden, sondern darum, dass sie die plötzliche Leere im Leben des jeweils anderen wohl am besten verstehen können. Dass Jerry von seiner Drogensucht eingeholt wird, gehört noch zu den leicht vorhersehbaren Entwicklungen. Aber wie er in seine Rolle als Ersatzvater hineinwächst und dann wieder herausgeschleudert wird, weil manches einfach nicht ersetzt werden kann und auch nicht ersetzt werden sollte, das kommt anders als erwartet und ist doch so leicht nachvollziehbar.
Loebs Drehbuch verwendet viel Zeit auf die Kinder (Micah Berry, Alexis Llewellyn), die beide ihre eigenen Ängste, ihre eigene Geschichte haben. Obwohl der Film keine zwei Stunden dauert, ist darin noch genug Platz für weitere ausgereifte Nebenrollen. Alison Lohman spielt eine ehemalige Drogensüchtige, die Jerry bei seinem Entzug hilft, und John Carroll Lynch ist ein Nachbar in der Midlife Crisis, neben Jerry der einzige Raucher, dessen Verzweiflung über sein eigenes Leben ihn nicht davon abhält, Jerry ein gutmütiger Freund zu werden.
Hollywood und Susanne Bier passen also besser zusammen als gedacht. Nicht zufällig werden zurzeit zwei Remakes vorbereitet. Jim Sheridan dreht Brothers neu, und Zach Braff wagt sich an Open Hearts.
Neue Kritiken

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple

Silent Friend
Trailer zu „Things We lost in the Fire - Eine neue Chance“
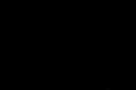
Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (6 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
me
Ich habe das Kino vorzeitig verlassen. Der so als anspruchsvoll gelobte Film erzählte fern jeglicher Realität die Geschichte "vom Junkie zum Familienvater" in 2 Wochen..., zumindest bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ich aus dem Kino ging. Auch wenn der Kritik zu entnehmen ist, dass der Suchtkranke dann wieder auszog, ist es wohl eher unwahrscheinlich, dass er überhaupt vorübergehend erst eingezogen ist. Die Dialoge waren äußerst flach, das ach-so-glückliche Familienklischee eine Darstellung von oberflächlichem, amerikanischem Materialismus, und manche Szenen wirkten geradezu lächerlich.

















1 Kommentar