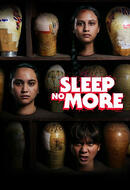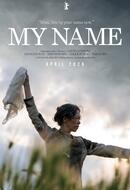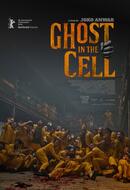Doch das Böse gibt es nicht – Kritik
Töten als Knopfdruck nach dem morgendlichen Kaffee: Mohammad Rasoulof exerziert in vier Episoden die Praxis der Todesstrafe im Iran durch. Moralische Fragen sind in Doch das Böse gibt es nicht nur solche der Umsetzung.

Mit reglosem, aber wachem Blick fährt Heshmat lange vor Sonnenaufgang durch die leeren Straßen Teherans – er ist das frühe Aufstehen sichtlich gewohnt. An seinem Arbeitsplatz angekommen, einer kahlen, engen Kammer mit einer fremdartigen Apparatur in der hinteren Wand, schaltet er erstmal den Wasserkocher an und schüttet mit einem Löffel etwas Kaffeepulver in eine Tasse. Hinter seinem Kopf fängt eine Reihe roter Lämpchen nervös an zu blinken, aber Heshmat bringt das nicht aus der Ruhe. Konzentriert gießt er das mittlerweile kochende Wasser in die Tasse und rührt mehrmals um. Da springen die Lämpchen hinter ihm plötzlich auf Grün. Heshmat nimmt einen tiefen Schluck Kaffee, wirft einen Kontrollblick durch das kleine Fenster neben der Apparatur und drückt dann einen schwarzen Knopf. Abrupt wechselt der Film die Szene und wir sehen in schockierender Deutlichkeit den grausamen Zweck der mechanischen Vorrichtung, sehen den wahren Charakter der Aufgabe, der Hashmet in aller Ruhe nachgeht.
Ein langer Film über das Töten

Mohammad Rasoulofs Doch das Böse gibt es nicht setzt sich in vier voneinander unabhängigen Episoden mit der Praxis der Todesstrafe im Iran auseinander. Dabei lenkt der Film sein Augenmerk vor allem auf das Schicksal der unmittelbaren Vollstrecker – auf die Angestellten und jungen Rekruten, die den Knopf drücken oder den Schemel unter den Verurteilten wegziehen müssen. Neben dem dienstbeflissenen Familienvater Hashmet verfolgt der Film nacheinander zwei Soldaten, die auf sehr unterschiedliche Weise mit dem Befehl zum Einsatz in einem Exekutionskommando umgehen, sowie einen alternden Arzt, der in einer steinigen Einöde mit einem alten Trauma ringen muss.
Allein schon diese episodische Struktur verleiht Rasoulofs Film etwas sehr Methodisches: Hier sollen verschiedene Aspekte eines gesellschaftlichen Phänomens schrittweise herausgearbeitet und durchleuchtet werden. Dabei sind die einzelnen Geschichten von einem jeweils anderen zentralen Gegensatz bestimmt: Die Verrichtungen und Zärtlichkeiten des Alltags werden dann etwa mit dem Grauen der berufsmäßigen Tötung kontrastiert und der persönliche Triumph, gegen alle Widerstände den eigenen moralischen Prinzipen gefolgt zu sein, steht neben dem Leid, das ebendieser Triumph für die Menschen, die einem am nächsten stehen, zur Folge hatte.
Nichts Beiläufiges, nichts Alltägliches

Aber gerade in seiner Zielstrebigkeit ist Rasoulofs Film oft allzu direkt lesbar. Am Anfang lassen die Episoden das Prinzip, das in ihnen verhandelt wird, und den Konflikt, um den herum sie organisiert sind, noch bewusst im Unklaren. Aber wenn sich das jeweilige Thema einmal herausgeschält hat, lässt sich jede Handlung, jeder Eindruck, jede Geste und jeder Blick unmittelbar auf dieses Thema rückbeziehen, und auch die frühere Mehrdeutigkeit erfährt nachträglich eine klare Ordnung, einen eindeutigen argumentativen Zweck. Momente der Beiläufigkeit und der Alltäglichkeit existieren in Doch das Böse gibt es nicht somit niemals für sich, sondern sind immer mit Bedeutsamkeit aufgeladen – sie treten einem immer im Gewand des Exemplarischen entgegen.
Entsprechend nüchtern fällt auch, zumindest über weite Teile, die Inszenierung des Films aus: Doch das Böse gibt es nicht hat nichts Polemisches, er überzeichnet nicht auf sarkastische oder satirische Art und Weise, aber er hat auch nichts Rührseliges oder Melodramatisches, jedenfalls nicht in dem Sinn, dass die Gefühlsausbrüche der Figuren beim Betrachten eine emotionale Reaktion auslösen sollten. Vielmehr breitet Rasoulof in jeder Episode einen inneren moralischen Konflikt Schritt für Schritt vor uns aus, legt ihn zur Beurteilung und zur individuellen Stellungnahme vor.
Der Moral Gehör verschaffen

Nur vereinzelt wird der betont distanzierte Tonfall des Films von plötzlichen pathetischen Aufwallungen durchbrochen. Die Tonebene drängt dann etwa mit heftigen Schlägen ins Geschehen, eine Flucht wird von den Klängen von „Bella Ciao“ begleitet oder ein Rekrut versenkt seinen Kopf im kalten Wasser eines Baches, um dann beim Auftauchen laut und schmerzerfüllt aufzuschreien. Aber auch diese Momente der Intensität bringen das argumentative Gerüst der einzelnen Episoden nicht ins Wanken und fügen ihrem exemplarischen Gestus nichts Eigenständiges hinzu. Die Emphase unterstreicht und betont, hebt aus dem bereits Etablierten einzelne Aspekte hervor – und macht so die beschriebene Situation noch deutlicher lesbar.
Gerade diese Momente, in denen sich eine potenzielle Unruhe allzu unmittelbar in die thematischen Anliegen des Films einfügt, machen den grundlegenden Zwiespalt spürbar, der Doch das Böse gibt es nicht einen beträchtlichen Teil seiner Wirkung nimmt. Denn zum einen sind die systematisch aufbereiteten Konfliktsituationen nicht kompliziert genug, um als abstrakte moralische Fallbeispiele interessant zu sein: In ihnen geht es nicht darum, mehrere widerstreitende moralische Impulse miteinander in Einklang zu bringen, sondern nur darum, ob man es schafft, den bereits erkannten moralischen Vorgaben Folge zu leisten. Zum anderen jedoch ist der Film zu wenig interessiert an der Vielgestaltigkeit und Unübersichtlichkeit des Alltags, um zu erkunden, wie sich moralische Vorgaben und Pflichten in dem tatsächlichen Erleben und Handeln eines einzelnen Individuums durchschlagen. Die Frage, was zu tun sei, ist in Rasoulofs Film allzu schnell geklärt, und die nach den Möglichkeiten moralischen Handelns beschränkt sich allzu sehr auf die reine Umsetzung – dabei muss sich das moralische Denken inmitten eines Gewirrs an persönlichen Wünschen, Sehnsüchten und Ängsten doch überhaupt erst einmal Gehör verschaffen.
Neue Kritiken

Ella McCay

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

No Other Choice

Ungeduld des Herzens
Trailer zu „Doch das Böse gibt es nicht“

Trailer ansehen (1)
Bilder

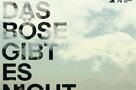


zur Galerie (6 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.