Der wilde Birnbaum – Kritik
Nuri Bilge Ceylans Der wilde Birnbaum bringt das Kino an seine Grenze zur Literatur und zu sich selbst.

Der Titel des Films ist der Titel des Romans. Sinan (Doğu Demirkol) ist ein junger Schriftsteller, gerade hat er sein Studium in Çanakkale und seinen Debütroman abgeschlossen: „Der wilde Birnbaum“ heißt dieser Text, den Sinan schnellgeheftet und auf der Suche nach Veröffentlichungsförderung mit sich herumträgt. Der Bürgermeister von Çan, Sinans Heimatstadt, in die er nach seinem Studium zurückkehrt, blättert durch den Hefter und lobt das Projekt auf der Suche nach Ausflüchten: Öffentliche Gelder könnten höchstens für Tourismusliteratur bereitgestellt werden, für Künstlerförderungen gäbe es keine Möglichkeiten; ob der Roman denn von lokalen Helden handeln würde…
Irgendwann im Laufe der 190 Minuten von Nuri Bilge Ceylans neuem Film Der wilde Birnbaum wird dieses Buch dann doch noch gedruckt. 500 Kopien gibt es – sie liegen mehrheitlich zu Stapeln verpackt in Sinans altem Kinderzimmer. Im Buchladen kauft es niemand, obwohl es über fünf Monate in der Auslage stand. Mutter und Schwester haben mal reingelesen. Er wisse ja, wie es ist, man komme ja kaum zum lesen, meinen sie. Tatsächlich wissen wir über die allerweitesten Strecken dieses Films nicht nur nicht, wovon dieses Buch handelt, das offenbar in Hinterland Anatoliens angesiedelt ist, konkreter im Naturraum um Çan, in dem wilde Birnenbäume wachsen. Wir wissen auch, dass es niemand weiß, da es niemand las oder liest.
Ein Kino auf dem Boden der Sprache

Ceylan hat mit diesem Film das Kino an die Grenze zur Literatur getrieben. Für ein nicht-türkisches Publikum zeigt sich dieser Grenzraum in den Untertiteln. Augenblicke, in denen nicht gesprochen wird, gibt es kaum. Im Gegenteil, die Sprache und das gesprochene Wort, sind geradezu Treibstoff dieses Films, der unermüdlich von einer ausladenden Dialogszene in die andere hineinfließt und von dort in eine wieder andere. Ein Film auf dem Boden der Sprache und des Sprechens; es gibt kein Fortkommen jenseits ihrer. Am schönsten zeigt sich das in einer Szene, in der Sinan telefonierend in die Innenstadt von Çan hinunterläuft – Feldwege beschreitend, Abkürzungen durchs Gebüsch nehmend, rostende Brücken überquerend. Am anderen Ende der Leitung ist ein alter Schulfreund, der nach seinem Literaturstudium zur Polizei ging – wir hören ihn deutlich sprechen aus dem über den Mobilfunk ins On getragenen Off. Jede filmische Bewegung ist eine Bewegung der Sprache. Sie ist die mediale Grundlage von Der wilde Birnbaum.
Und trotzdem: Das Kino und die Literatur lassen sich so einfach nicht synchronisieren, denn die Literatur schweigt. Wovon Sinans Roman handelt, wissen wir nicht, weiß niemand so recht. Ein sprechender Film über das Schweigen der Literatur – eine Art Ansprechen gegen das Schweigen. Ihn interessiere der Kern der Literatur nicht, meint ein erfolgreicher Schriftsteller einmal zu Sinan, nachdem sie sich in einer weiteren wunderbaren Szene aus einem Buchladen heraus auf eine Brücke in Çanakkale dialogisiert hatten. Momentan interessiere ihn nur die Migräne, die ihn plage. Wieder schweigt die Literatur. Sie schweigt im wütend-brüllenden Gesicht ihres Urhebers.
Stumme Gebiete

Das Verhältnis von Ceylans Kino zur Prosa muss man deshalb in diesem Zwiespalt beschreiben: Sprechen und Schweigen. Und tatsächlich ist Der wilde Birnbaum wie das filmgewordene Intervall dazwischen. Gesprochen wird immer, aber universeller noch ist das Verschwiegene dieser sattgelben Welt an der Nordägäis und der Menschen, die sie beleben. Es liegt ein stummer Raum zwischen Vater und Sohn, ein Gebiet, in das der Film immer tiefer eindringt. Idris (Murat Cemir) ist Lehrer an einer Grundschule. Er ist bankrott und spielsüchtig, ein Loser, meint der Sohn einmal. Der Strom in der Wohnung wurde abgestellt, nachdem Idris die Rechnungen nicht mehr bezahlen konnte. Das Lachen des Vaters ist herzlich, aber auch gebrochen, es klingt wie das Zerbrechen des Körpers vor dem Weinen – und manchmal weint er auch nachts am Esstisch sitzend. Mutter Asuman (Bennu Yildirimlar) verzweifelt an ihrem Ehemann – aber müsste sie sich noch einmal sechzehnjährig für ihn entscheiden, sie würde es sofort wieder tun. Während früher alle von Karriere und Geld sprachen, sagt sie einmal zu Sinan, hätte Idris von der Natur, ihren Früchten und ihren Farben gesprochen. Er habe schön gesprochen und er spreche heute noch schön, fügt sie hinzu. Und er ist der Einzige, der irgendwann dann doch in Sinans Buch geguckt haben wird.
Der Zugriff des Kinos auf die Verschwiegenheit der Welt

Von allen Motiven, die Ceylans Film sprechend durchkreuzt – sei es die Kunst, die Natur, die Familie, die Politik, die Religion, die Liebe oder die Arbeit – ist das schönste am Ende die Schönheit des Sprechens selbst. Und es ist verblüffend, wie sehr einen diese Schönheit trotz der Arbeit, die sie einem bereitet (das Zuhören, das Mitlesen der Untertitel), in ihren Bann zieht. Womöglich liegt es daran, dass alles von ihr abhängt, dass diese fließend-komponierte Welt, deren staubig-trockenes Gelb Ceylan Einstellung für Einstellung meisterhaft extrapoliert, nur vermittels ihrer gehandhabt werden kann. Der wilde Birnbaum ist der Zugriff des Kinos auf die Verschwiegenheit der Dinge und der Welt – aber nicht, weil sie in diesem Film zu sprechen beginnen würde, sondern, im Gegenteil, weil das Schweigen der Welt hörbar wird, sobald die Sprache schön wird, sobald sie Literatur wird, aber eben gerade noch nicht ist.
Neue Kritiken

Primate

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail
Trailer zu „Der wilde Birnbaum“

Trailer ansehen (1)
Bilder
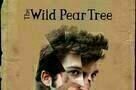



zur Galerie (7 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.












