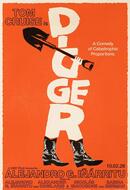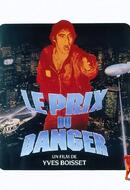The Village Next to Paradise – Kritik
Das Rauschen des Windes, das Rauschen der Drohnen: Mo Harawes erster Langfilm erzählt vom Leben in einer Welt, deren Härten keine greifbaren Urheber haben. Resignativ ist The Village Next to Paradise dabei keineswegs, vielmehr erzählt er von einer Gemeinschaft, die sich im Gegenwind behauptet.

Bloß nicht hingucken. Die Hände vor die Augen und bloß nicht hingucken. Das ist der so simple wie grundlegende Auftrag, den Vater Mamargade seinem Sohn Cigaal gibt. Sie sind gerade im Krankenhaus, als durch einen Drohnenangriff verletzte Personen angeliefert werden. In Paradise, einem somalischen Dorf an den Ufern des Indischen Ozeans, ist das keine Seltenheit: Die unsichtbare Gefahr der amerikanischen Predator-Drohnen ist hier genauso omnipräsent wie der ewig wehende Wind. Sie sind wie ein fünftes Element, ein Geräusch, eine Explosion, Opfer, aber keine Ursache weit und breit. Es ist eine harsche Lebensrealität, die Regisseur Mo Harawe in seinem ersten Langfilm The Village Next to Paradise etabliert. Eine Welt, die ihren Bewohnern immer gerade genug zum Überleben gibt. In dieser Welt machen sich die Protagonisten des Films, Mamargarde, seine Schwester Araweelo und sein Sohn Cigaal, auf, dem Leben dennoch ein Stück mehr abzutrotzen.

Und abtrotzen muss man dieser harschen Landschaft jeden Zentimeter. Niemand weiß das besser als Mamargade, der sein Geld damit verdient, Gräber aus dem trockenen Boden auszuheben. Während das örtliche Bestattungsunternehmen mit Baggern anrückt, hat er nichts als eine Spitzhacke, eine Schaufel und seinen Stoizismus. Als die örtliche Schule geschlossen wird und Cigaal auf ein Internat in der nächstgelegenen Stadt muss, wird die finanzielle Last nur noch größer. Parallel kämpft Schwester Araweelo darum, sich ihren Traum von der eigenen Schneiderei zu erfüllen. Ein Traum, der nicht wahrscheinlicher wird, nachdem ihre Ehe wegen Kinderlosigkeit endet.
Zwischen Ruhe und Betäubung

The Village Next To Paradise erzählt diese Kämpfe nicht als anschwellende Dramaturgie, sondern so, wie sie sich für die Figuren anfühlen: als Abfolge mühsamer Tage, einer dem anderen gleich. Ein lakonischer Schauspielstil dupliziert sich in einer ebenso nüchternen Kameraführung: In stillgestellten, meist hüfthohen Einstellungen bleibt die Kamera meist auf der Höhe der Menschen und sucht die Nähe der Figuren. Das öffnet Raum für das, was die Kamera nicht einfängt und häufig noch bedeutsamer ist. Mo Harawe setzt nur ganz selten Musik ein, stattdessen werden die Hintergrundgeräusche zum Soundtrack des Films – das Dorftreiben, spielende Kinder und immer wieder das Wehen des Windes. Doch davon geht nicht nur eine harmonisierende Wirkung aus. Die Erinnerung daran, dass jederzeit das Geräusch der vorbeifliegenden Drohnen den Alltag durchschneiden kann, verschwindet nie ganz.

In Harawes Film sind die Bilder und Eindrücke immer auf der Kippe. Dem ewigen Ernst der Gesichter ist selten eine klare Emotion abzulesen. Verstärkt wird das durch Szenen, die den in der gezeigten Gesellschaft verbreiteten Konsum des Kathstrauches vorführen. Wenn die Kathblätter gekaut werden, haben sie eine schwache berauschende Wirkung. Klingt der Rausch ab, werden die Konsumenten müde und matt. Wie jede Droge verunklart der Kathkonsum die Wahrnehmung: Harawe balanciert mit seinen Bildern und der Art, wie er seine Schauspielerinnen und Schauspieler einsetzt, auf der feinen Linie zwischen Ruhe und Betäubung.
Emanzipatorisches Potenzial

Wenn Mamargade gerade keine Gräber aushebt, verdingt er sich ab und zu als Fahrer. Dann bekommt er einen LKW ausgehändigt mit einer Ladung, die er nicht weiter hinterfragt. Er fährt einfach. Er fährt einfach und hofft, dass bei den ständigen Polizei-Kontrollen nicht zu genau hingeschaut wird. Von wem die Ladung kommt, was mit ihr geschieht, bleibt unklar, wie vieles in diesem Film. The Village Next To Paradise, der als erster somalischer Beitrag in Cannes in der Sektion „Un Certain Regard“ gezeigt wurde, kreiert eine Welt der fehlenden Urheberschaft. So wie die meisten Geräusche im Film keine Quelle im Bild haben, so haben die Umstände, in denen die Figuren leben, keinen Urheber. Mamargade, Cigaal und Araweelo sind in eine Realität geworfen, in der es normal ist, dass das Leben beschwerlich ist und in der sie mit der ständigen Bedrohung durch Drohnenangriffe leben müssen.

The Village Next To Paradise ist jedoch kein Film der Resignation. So wie der stoische dreinschauende Mamargarde trotz aller Widrigkeiten jeden Tag die Schaufel in die Hand nimmt, so gibt Araweelo ihren Traum vom eigenen Laden nicht auf. Das ist kein Ausdruck einer naiven Stehaufmännchen-Ideologie, sondern darin liegt emanzipatorisches Potenzial: Im Laufe des Films erzählt Mamargade die Geschichte davon, wie er zu Cigaals Vater geworden ist. Denn der ist gar nicht sein leiblicher Sohn, das Schicksal hat die beiden zusammengebracht. Und so bilden Mamargade, Cigaal und Araweelo eine Gemeinschaft. Nicht weil sie müssen, sondern weil sie sich dafür entschieden haben. Sie leben in einer Welt voller Kräfte, die sie entmündigen wollen. Die eigenen Entscheidungen im Gegenwind zu treffen, ist ihre Form des Widerstands. Denn darum geht es in Mo Harawes meisterhaft inszenierten Film: Sich die Urheberschaft über das eigene Leben nicht nehmen zu lassen.
Neue Kritiken

Silent Friend

Small Town Girl

Der Fremde

Holy Meat
Trailer zu „The Village Next to Paradise“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (17 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.