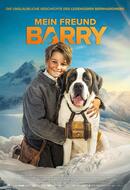Das Tier im Dschungel – Kritik
Was ist schon die Welt, was ist schon die Zeit, wenn der Bass dröhnt, der Körper schwitzt, der Beat die einzig sinnvolle Struktur vorgibt, in der es sich leben lässt. In Das Tier im Dschungel gibt es nur den Moment und die Musik, die Präsenz und das Präsens.

Ein Geheimnis steht am Anfang des neuen Films von Patric Chiha, und es bleibt auch dann noch eines, wenn er endet. Das ist die Geste, in der Das Tier im Dschungel gelesen werden will: dass es etwas gibt, das sich der Wahrnehmung vorenthält, das im Verborgenen bleibt beim schieren Erfahren dieser 103 Minuten, in denen wir auf die Oberfläche starren, die sich Leinwand nennt, und uns danach sehnen, dass von den Bildern etwas auf uns zurückstrahlen möge, sich etwas zeigt, reflektiert, was Bedeutung, Antwort, Erlösung bietet. Sie wird nicht kommen, die Eindeutigkeit, Das Tier im Dschungel inszeniert die Unmöglichkeit ihrer Erscheinung schon immer direkt mit und hüllt sie in einen Schatten der Hoffnung; ein durchlässiger, offener, offensiver Film, der nicht versteckt, was er unternimmt, wie ein Zauberer, dessen Ärmel immer noch faszinieren können, nachdem er angekündigt hat, was sich darin befindet.
Die maximale Gegenwart feiern
Ein anderer Zauber, die Vergangenheit, die Jugend. Auf einer pubertären Parkplatzparty hat John (Tom Mercier) seine Bestimmung einst mit May (Anaïs Demoustier) geteilt, zehn Jahre ist das her, belegt die Rückblende, bevor sich die beiden in einem Club ohne Namen wiedersehen. Ein Déjà-vu auf der Toilette, ein Blick, dann ein zweites, drittes fragendes Abtasten mit den Augen, ob es nicht bloß die Erinnerung, sondern Zuneigung sein könnte, die sie verbindet, ihn, der nicht tanzen will, mit ihr, die nicht damit aufhören kann.
Loskommen werden sie nicht mehr voneinander und von diesem Ort, der sich in Paris befindet, aber auch in Berlin sein könnte, denn was ist schon die Welt, was ist schon die Zeit, während der Bass dröhnt, der Körper schwitzt, der Beat die einzig sinnvolle Struktur vorgibt, in der es sich leben lässt. Falls das, was May und John tun, denn überhaupt noch als „Leben“ beschreibbar ist: Wie ein Königspaar thronen sie bei Chiha über der Tanzfläche, jedes Wochenende wieder, beobachten vom Sofa auf dem Balkon aus diejenigen, die sich unter ihnen bewegen und die maximale Gegenwart feiern, indem sie völlig als Leiber aufgehen, die vergehen werden, aber nicht jetzt, nicht hier, in Das Tier im Dschungel gibt es nur den Moment und die Musik, die Präsenz und das Präsens.

Bis das Ziffernblatt zerspringen darf
Ganze 25 Jahre wird das so laufen. Ein Fernseher verbindet den Club, der nun einen Namen trägt, mit einer neuen Welt, berichtet von der Wahl Mitterands, vom Mauerfall, dann von der Verwandlung dieser vermeintlich neuen Welt in eine alte, als zwei Flugzeuge in das World Trade Center einschlagen. Johns billige Anzüge und seine Einsamkeit werden bleiben, Mays Freund*innen langsam verschwinden, unauffällig, schleichend, sukzessive verabschieden sie sich aus der Szene, Job, Familie, Aids. Ein verändertes Publikum kehrt zurück, die Farben der Kleider verblassen (wenn denn die Menschen überhaupt noch welche tragen), aus synthetischen Disco-Klängen wird House, Acid, Techno, peitschender Industrial, irgendwann Schranz, schneller, mehr, mehr, so wollen es diese Gemeinschaft und dieser Film, härter noch dazu, Hardstyle halt, wo im permanenten Aufbau das Orgiastische, das Ekstatische liegt, und weniger im Finale, als das Ziffernblatt endlich zerspringen darf.
Vielleicht ist Das Tier im Dschungel selbst irgendwann erschöpft, von sich selbst, durch sich selbst, an nichts anderem kann es liegen bei Chihas enigmatischem Film, der nun mal auch ganz schön nerven kann, weil er sich selbst als so enigmatisch, so parabelhaft, so erhaben inszeniert. Aber was Das Tier im Dschungel, der auf der gleichnamigen Novelle von Henry James basiert, alles wagt, was er anstellt mit Licht, Sound, mit dem Kinosaal, einem sozialen Ort, an dem wir zusammenkommen und Zeit miteinander teilen, hoffen, träumen, uns sehnen und verlieben, wenn sich die Arme auf der Lehne berühren, warten, wie gelähmt, auf den Tod und das Leben, das wir mit jenem Warten gleichsam verpassen; was dieser Film demonstriert, indem er Menschen filmt, die auf Menschen schauen: Das ist schon ziemlich besonders.
Es geht ja wieder, dieses Kino!

Es geht ja wieder, dieses Kino, ein Satz, der zurzeit überall auf dem Festival zu hören ist. Und es ist unbestreitbar, dass es sich bei Das Tier im Dschungel um eine Vertreterin des postpandemic cinema handelt, das von dem zu schwärmen weiß, was die letzten Jahre ausschließlich eingeschränkt stattfinden konnte – und, das wird gerne vergessen, für viele Menschen immer noch nicht möglich ist, wie beispielsweise der Besuch der diesjährigen Berlinale. Nicht nur deshalb ist Chihas Projekt in gewisser Weise ein Film, der Abwesenheit markiert, sondern auch, weil er selbst die Kranken, die Schwachen, die Langsamen abserviert, wenn die letzte große Pandemie des 20. Jahrhunderts zum Bild einer leeren Tanzfläche verkommt, das unter Beihilfe von Béatrice Dalle als Türsteherin und Erzählerin in einer einzigen Szene flott abgefertigt werden kann.
Ob Das Tier im Dschungel eine explizit queere Geschichte des Dancefloors entwirft (im Berghain hätten Chiha, Mercier und Demoustier recherchiert, na gut), ob er wirklich daran interessiert ist, über Armut nachzudenken, über Verlust und Trauer, das ist fraglich; wenn, dann gibt es nur die eigene Existenz zu bedauern und das sie nicht unendlich ist, stattdessen rauschhaft vorüberzieht, als wäre sie ein Zug, durch dessen Fenster sich kurze Blicke auf Küsse, Kotze, Kunst erhaschen lassen. Der Körper kommt an seine Grenzen bei Chiha, hingebungsvoll führt er ihn dorthin, um ihn als unüberwindbar vorzuführen und dennoch zu imaginieren, wie schön es wäre, einfach aus ihm aussteigen zu können.
Neue Kritiken

No Bears

Scarlet

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother
Trailer zu „Das Tier im Dschungel“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (4 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.