Styx – Kritik
Styx kommt wie ein Abenteuerfilm daher, doch die Herausforderung, vor die er eine Ärztin auf offener See stellt, ist mit Heldentaten nicht zu lösen.

Am Anfang gibt es Affen zu unheilvoller Musik. In menschengemachter, aber menschenleerer Szenerie schwingen sich die Tiere ohne Eile, dafür elegant gefedert über Leitern, Zäune und Elektrokabel. Die Sequenz hat etwas Postapokalyptisches, strahlt ein unsichtbares Übel aus, ähnlich einem verseuchten Gebiet, das kein Leben mehr bergen kann. Etwas ist aus den Fugen geraten in der Welt der Menschen, etwas ist durchsetzt mit Tod. Der ganze Film hält es wie die Einleitung, ja wie die Affen: Styx erkundet nicht die Ursachen, sondern führt elegant durch die Folgen, durch die unabwendbaren Folgen. Mag er auch wie ein Abenteuerfilm daherkommen, mit Mut, Kraft und anderen heroischen Eigenschaften ist die Herausforderung, vor der er seine Protagonistin stellt, nicht zu lösen. Styx fragt nicht, was wir an ihrer Stelle tun würden; er fragt, warum nichts, was sie tun könnte, Heil bringen würde.
Die Faszination der Beherrschung

Eine kurze Exposition verortet sie (Susanne Wolff) als deutsche Notärztin. Dann sehen wir, wie sie in Gibraltar mit einer zwölf Meter langen Segelyacht die Reise zur Südatlantikinsel Ascension antritt. Die bildgewaltigen Szenen leben von der Faszination, die jemand ausstrahlt, der sein Handwerk beherrscht. Wir werden nicht erfahren, wie die Alleinseglerin heißt. Funkgespräche eröffnet sie immer mit dem Namen der Segelyacht, „Asa Gray“. Umso mehr verschmilzt sie mit dem Boot, das filmisch zur Verlängerung ihres eigenen Körpers wird. Das Meer büßt dabei oft seine satten Farben ein. Nicht mit dem Kolorit sommerlicher Segeltouren gen Süden möchte der Film berauschen, sondern mit dem fortwährenden Kraftakt, das Boot unter die eigene Gewalt zu bringen und mit ihm das Meer zu bezwingen. Dafür bricht Styx das geschmeidige Brausen in Einzelteile, die Einzelteile in einzelne Handgriffe, die die Protagonistin immer wieder mit höchster Konzentration ausführt und die der Film geradezu ehrfürchtig, oft in voller Länge zeigt. Die Beziehung zum Boot erscheint als ein unentwegtes Ringen, aber auch als eine unentwegte Partnerschaft. Bald erfährt man den Sog des Segelns am eigenen Körper, ganz eingenommen vom Soundtrack, den der Törn entwickelt und der jede Musik überflüssig macht: das Wasser, der Wind, das Piepen der Armbanduhr, das die Protagonistin in regelmäßigen Abständen wieder zur Pflicht ruft.
Die deutlichen Konturen des Unscharfen

Bis dahin – ein gutes Drittel von Wolfgang Fischers Film – ist Styx die Geschichte einer Frau, die alles unter Kontrolle hat. Den anfänglichen Notfalleinsatz in Deutschland bringt sie routiniert über die Bühne, die „Asa Gray“ führt sie souverän durch den Sturm. Ob im Notfalleinsatz oder auf See, die Gesten sitzen. Dann drängt sich ein havarierter Fischkutter in ihr Sichtfeld, ein grauer Klotz in der Ferne, auf dem eine unförmige Menschenmasse gestikuliert; ein Schlepperboot in Seenot. Styx verweigert sich der formelhaften Losung, das Gesicht hinter den Zahlen zu zeigen, das Einzelschicksal aus der Menge herauszuschneiden, um Verständnis und Mitgefühl anzuregen. Die Flüchtlinge betreten diesen Film genau so, wie sie zumeist Eingang in die Berichterstattung finden: als eine ferne, undefinierte Menschenmenge, die nicht zur Sprache kommt. Der Fischkutter ist unscharf durch das schmale, die Sicht einschränkende Fenster der „Asa Gray“. Die Protagonistin muss nicht näher ranfahren, Styx muss nichts weiter zeigen: Wir wissen, dass sie weiß, und der Film weiß, dass wir auch wissen. Die Protagonistin setzt einen Notruf ab, der erwidert wird. Allmählich wird aber klar, dass die Küstenwache für Flüchtlinge keine Rettungsmission schickt; ebenso wie klar ist, dass sich die kleine „Asa Gray“ selbst in Gefahr begibt, wenn sie sich dem Fischkutter nähert.

Eine Küste – oder gar das Ziel des Törns – ist nie in Sicht. Styx wirft seine Protagonistin in einen Raum, dem Bezugspunkte abhandengekommen sind, dem nur menschliche Einwirkung – die Karte, auf der die Protagonistin immer wieder mit einem Zirkel die Entfernung ausmisst, das Navigationsgerät, das sie immer wieder anschaltet – den Anschein von Konturen, Grenzen, Ordnung geben kann. In diesem Raum ohne Bezugspunkte spielt sich ein Drama ab, das von unterschiedlichen Bezugssystemen herrührt. Denn die Protagonistin und die Flüchtlinge mögen sich in diesem Raum begegnen, in ihren Körpern aber ist ein anderer Raum eingebrannt, einer, der darüber bestimmt, wie viel ihr Leben wert ist und besonders, ob er eine Rettungsmission wert ist.
Die Szenerie beherrschen

Der anfängliche Noteinsatz – ein Verkehrsunfall – bekommt in der Rückschau eine ganz andere Bedeutung. Es sind nicht mehr die Gesten der Notärztin, die in Erinnerung gerufen werden, sondern ihre Einbettung in ein System, ihre Abhängigkeit vom System. Die Gesten der Protagonistin vermögen es hier, ein Leben zu retten, weil sie Teil einer reibungslosen Kette sind, die selbst Ausdruck und Ergebnis eines gesellschaftlichen Konsenses ist: dass alles Menschenmögliche unternommen wird, um Opfer von Verkehrsunfällen zu retten. Im Atlantik stößt die Protagonistin aber auf eine andere Logik: dass nicht alles Menschenmögliche unternommen wird, um schiffsbrüchige Flüchtlinge auf hoher See zu retten. Ihre eigene Hilfsbereitschaft läuft leer, sie ist hier zum Scheitern verurteilt. Styx erkundet die Handlungsfähigkeit des einzelnen Menschen und zeigt, wo sie an ihre Grenzen stößt. Der Film fragt nicht nach der individuellen, unmittelbaren Verantwortung. Vielmehr fragt er, warum sie hier erfolglos bleiben muss; warum es keinen Helden mehr geben kann und welche Verantwortung wir hierfür tragen.
Neue Kritiken

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother

The Day She Returns

Prénoms
Trailer zu „Styx“


Trailer ansehen (2)
Bilder




zur Galerie (10 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
fifty
Danke für Ihre scharfen Beobachtungen! Allerdings fände ich es bedauerlich, wenn der Film nur eine Schwäche unserer Zeit transportieren würde und uns ein weiteres Mal mehr erlaubt, humane Entscheidungen und Handlungen zu bloßen Gesten zu degradieren. Es gibt keinen falschen Ort, etwas Richtiges zu tun und das Richtige zu tun ist grundsätzlich heldenhaft. Wenn Heldentum verblutet weil politische Institutionen versagen, sind doch nicht die Helden plötzlich die Versager. Dass der Humanismus nicht die politische Basis hat, die er verdient, scheint uns allen medial schon längst klar – wozu noch eine Bestätigung im Kino? Ich will mich trösten, dass im Film ja sehr wohl eine Heldin existiert, die klassischerweise bereit ist sich zu opfern und die nicht vollends ins Leere läuft. Sie teilt das Menschenrecht (die Münze unter ihrer Zunge!) mit den Rechtlosen. Ihr sind angesichts der Not Herkunft und Bezugssystem egal. Genau das ist Humanismus. Was ich dementsprechend viel lieber „eingebrannt“ sehen würde, ist der Affe als positiv gemeinter Hinweis auf unsere Wurzeln und die Fähigkeit künstlich festgesetzte Räume zu überwinden. (Wie wir wissen, lag der Erfolg unserer Spezies in der Solidarität und nicht in der Ignoranz). Da der Film leider in der westlichen Perspektive stecken bleibt und der anderen Seite kaum Stimme und Gesicht zuspricht, wünsche ich mir eine konsequente Fortsetzung: Sie spielt in einem Gerichtssaal und wäre ein echter Tauchgang unter die mediale Untergangsbetroffenheitsoberfläche, die uns so gerne für tot erklärt.
Manon Cavagna
Vielen Dank für Ihre Anmerkungen! Dass es in diesem Film sehr wohl eine Heldin gibt – oder zumindest jemanden, der das Zeug zum Helden hat -, damit bin ich einverstanden. Die Heldentat allerdings bleibt meiner Meinung nach aus, weil die potenzielle Heldin hier zu wenig im Griff hat, weil es zu wenig gibt, auf das sie einwirken kann. Sie wird mit den unausweichlichen Konsequenzen von Entscheidungen konfrontiert wird, die an anderer Stelle getroffen worden sind. Ihr Heldentum und ihr Humanismus können sich hier nicht entfalten, weil der Welt, in der sie sich bewegt, der Humanismus schon abhandengekommen sind.
Sie schreiben, dass Sie es bedauern, dass der Film in der westlichen Perspektive stecken bleibt und der anderen Seite kaum Stimme und Gesicht zuspricht. Tatsächlich ist das für mich das Wesen und die Stärke dieses Films, denn es geht hier um uns. Die Protagonistin ist natürlich allein durch ihr Projekt, von Gibraltar zur Ascension-Insel zu segeln eine Ausnahmeperson; dass sie auf hoher See auch noch schiffsbrüchigen Flüchtlingen begegnet, macht ihre Situation noch einzigartiger. Doch abstrahiert man ein wenig, versetzt sie der Film eigentlich in genau unsere Lage. Auch in (den meisten von) uns regt sich Hilfsbereitschaft und Empörung, wenn wir mit den Bildern schiffsbrüchiger Flüchtlinge konfrontiert werden. Doch wie dieser Hilfsbereitschaft Ausdruck verleihen? Wie helfen? Die Protagonistin verkörpert genau diese Dissonanz: auf der einen Seite der menschliche Drang zu retten und zu helfen; auf der anderen, die Einsicht, dass wir in einer vertrackten Welt leben, in der wir (als Individuum allemal) keinen unmittelbaren Einfluss mehr darauf haben, ob Menschen auf dem Weg nach Europa ertrinken.
fifty
Ich bin kürzlich auf folgende Zeilen Ihres Kollegen gestoßen, die mich nochmal an diesen Film hier denken ließen:
„Sowohl dem Flüchtlingsdiskurs wie dem sozialrealistischen Kino wird ja oft eine Geste der Reduktion vorgeworfen. Ersterem, weil man da Menschen nicht als Individuen, sondern als bloße Träger kollektiver kultureller Merkmale bespricht, die Vielfalt je einzelner Schicksale in Begriffen von Krise und Phänomen, in Bildern von Wellen und Massen zusammenfasst, die sich vor die konkrete Realität schieben. Dem Kino dagegen, das sich dieses Krisenphänomens derzeit so gern annimmt, lässt sich in der Regel weniger die Verzerrung dieser Realität vorwerfen als die Hörigkeit ihr gegenüber. Aus Mangel an Fantasie übt man sich in Verdopplung, sperrt die, denen man Gehör verschaffen will, in ihre eigene Erfahrung ein, unterwirft sie denselben Gesetzen, von denen sie ohnehin schon drangsaliert werden. Steht das Bild im einen Fall der Realität im Weg, so die Realität im anderen Fall dem Bild.“ (Til Kadritzke in einer Kritik zum Film „Jupiter Moon“ von Kornél Mundruczó)


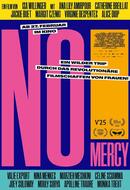
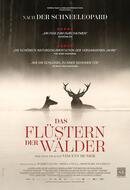
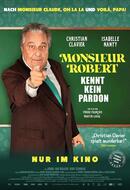








3 Kommentare