Still Walking – Kritik
Nur einen Tag lang begleiten wir eine japanische Familie und erfahren dabei doch ihre ganze Geschichte. Auch mit seinem neuesten Werk beweist Hirokazu Kore-eda, dass er einer der stilsichersten Regisseure seiner Zeit ist.

Auf dem Foto, das später Zeugnis ablegt vom Familientreffen der Yokohamas, werden zwei wichtige Familienmitglieder fehlen. Der älteste Sohn Junpei ist vor bereits 15 Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen – das Gedenken an seinen Tod ist Anlass für die Zusammenkunft der Großfamilie im Elternhaus, von dem dieser Film erzählt. Junpeis Vater Shohei (Yoshio Harada) ist zwar quicklebendig, hat für den Besuch seiner Kinder und Enkelkinder aber nicht viel übrig und verlässt das „Fotoshooting“. Shoheis Übellaunigkeit hängt mit dem Tod Junpeis zusammen: Dieser war auserkoren, die väterliche Arztpraxis zu übernehmen, während der jüngere Ryota (Hiroshi Abe) seinen Vater ein ums andere Mal enttäuscht hat: zuletzt durch die Hochzeit mit der verwitweten Yukari (Yui Natsukawa), die ihren zehnjährigen Sohn aus erster Ehe zum ersten Mal den neuen Großeltern vorstellt.
Die Rekonstruktion eines vergangenen Dramas
Abwesenheit ist das zentrale Motiv in den Filmen Hirokazu Kore-edas. Im fantastischen After Life (Wandâfuru raifu, 1998) ging es um die Abwesenheit des Lebens selbst: In einer Zwischenstation vor dem Himmel versammeln sich kürzlich Verstorbene, um eine Erinnerung aus ihrem Leben auszusuchen und sie mit ins Jenseits zu nehmen. Und auch in seinem bislang stimmigsten und bekanntesten Film Nobody Knows (Dare mo shiranai, 2004) erzählt Kore-eda nicht die Geschichte der alleinerziehenden Mutter, die mit unterschiedlichen Männern vier Kinder gezeugt hat, sondern die des 12jährigen Akira, der sich um seine jüngeren Geschwister kümmern muss, nachdem die Mutter sie im Stich gelassen hat.
In allen Filmen entdecken wir Spuren der Vergangenheit, und die Handlung in der Gegenwart hilft uns, vergangene Dramen zu rekonstruieren: das der Mutter, die ihre Kinder verstecken muss, um gesellschaftlich nicht geächtet zu werden; das der Toten, die angesichts des erzwungenen Rückblicks ihr Leben reflektieren müssen; und hier nun das der Familie Yokohama. Mit Still Walking erreicht Kore-edas implizite Erzählweise ihren Höhepunkt: Die eigentliche Handlung spielt sich innerhalb von weniger als einem Tag ab – und beschwört doch eine ganze Familiensaga.

Dabei hat man zu keiner Zeit das Gefühl, Kore-eda würde es sich leicht machen und uns die Vergangenheit der Familie mithilfe von konstruierten Bemerkungen der Figuren erklären. Die präzise geschriebenen Dialoge enthüllen zwar einiges über die Geschichte der Yokohamas, kommen aber so natürlich daher, dass man nicht einmal an ihre dramaturgische Funktion denkt. Bei der Inszenierung erreicht Kore-edas Film seine erstaunliche Authentizität dann nicht durch dokumentarische Mittel, sondern über die Kraft des Kinos: der poetischen, aber nicht pathetischen Bildsprache, der dezent eingesetzten Filmmusik, einer durchdachten Montage und vor allem seinem verblüffend intuitiven Gespür für Timing. Wenn Mutter Toshikos (Kirin Kiki) Monolog über den Tod ihres Sohnes jäh durch die herumtobenden Kinder unterbrochen wird, oder wenn der mürrische Patriarch nach endlosem Schweigen doch einen Kommentar zum Gespräch fallenlässt und damit die ganze Familie zum Verstummen bringt, dann denken wir nicht über filmische Mittel nach, sondern sind mittendrin im Kosmos der Yokohamas.
Kore-eda, ein neuer Ozu?
Vor allem seit Still Walking wird Kore-eda mit dem japanischen Meisterregisseur Yasujirō Ozu verglichen. Und tatsächlich erinnern nicht nur bestimmte Bilder oder handwerkliche Verfahren an das große Vorbild. Man kann diesen Film durchaus als Hommage und Aktualisierung von Ozus Meisterwerk Tokyo Story (Tôkyô monogatari, 1953) sehen. In beiden Werken geht es um einen Familienbesuch, den Tod eines Sohnes und die gesellschaftliche Stellung der Witwen, beide behandeln gesellschaftliche Konventionen und ihre Rückwirkung auf die Familie, und in beiden Fällen ist das jeweilige Opfer dieser Konventionen die Seele des Films.

Ein weiteres Motiv, das in Kore-edas Filmen auftaucht und dessen sich auch Ozu häufig bediente, ist die Betonung der Semantik von Innen- und Außenszenen. Schon in After Life war das Innen die Enge des gesellschaftlichen Lebens, das Außen der befreite Blick der Wahrheit, und auch in Kore-edas realistischen Filmen taucht dieses Prinzip auf: Die Wohnung erscheint als bedrängender Ort der Rituale, in dem jeder Mensch darauf bedacht ist, sein Verhalten an die Erwartungen anderer anzupassen, als Raum der Konventionen, die Patriarch Junbei schon durch die Anwesenheit von Ryotos neuer Frau und deren Sohn gebrochen sieht. Drinnen dürfen derartige Konflikte nicht offen ausgesprochen werden, und doch kommt es zu Störungen und Irritationen, weil eine japanische Wohnung zu klein ist für die vielen Geheimnisse und versteckten Vorwürfe einer ganzen Familie.

Demgegenüber erscheint das Außen, die freie Natur, als Raum der Freiheit. Schon Akira, der kleine Held aus Nobody Knows, erlebte nur im Freien wenige Momente des Glücks. In Still Walking nun sind es die Erwachsenen, die sich dort ein wenig Aufrichtigkeit erlauben. Die Gespräche erscheinen ehrlicher, die Figuren kommen uns näher, nur draußen ist so etwas wie Kommunikation möglich. Es ist kein Zufall, dass Kore-eda unsere Aufmerksamkeit wie schon in Nobody Knows immer wieder auf eine Treppe lenkt, welche diese beiden Räume zugleich trennt und verbindet – Innen und Außen liegen für ihn auf unterschiedlichen Ebenen, und ein Übergang ist nur mit einer gewissen Anstrengung zu leisten.
Diese Metapher kommt so beiläufig und wenig melodramatisch daher wie der ganze Film, und ebenso überlegt muss auch das Urteil über den Regisseur ausfallen: Kore-eda als „neuen Ozu“ zu bezeichnen, wird beiden nicht gerecht, weil ihre Filme nicht zuletzt auf die Schwierigkeiten einer wahren Verständigung zwischen unterschiedlichen Generationen verweisen. Aber beide verbindet ein Bewusstsein über etwas, das Ryota in Still Walking formuliert, und das weit weniger trivial ist, als es vielleicht anmutet: „Wir sind doch nur Menschen.“
Neue Kritiken

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho
Trailer zu „Still Walking“

Trailer ansehen (1)
Bilder

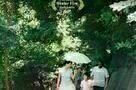


zur Galerie (9 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.











