Sterben – Kritik
In Matthias Glasners multiperspektivischem Familienepos ringt jede Figur auf ihre Weise damit, Schmerz in Sinn zu verwandeln. Der ausgestellte Intellektualismus des Films wird dabei immer wieder von absurdem Humor und exzessivem Chaos durchbrochen.
Der schmale Grat

Der erste Witz von Sterben steckt wohl darin, dass er größtenteils vom Leben handelt. Ja, der Tod ist stets ein Begleiter in Matthias Glasners Film, stößt ihn an, treibt ihn voran, doch der Fokus liegt auf denen, die zurückbleiben. Wie sehr der Film berührt, ist bestimmt auch davon abhängig, welche Tangenten zwischen unseren Biografien und denen der gebrochenen Figuren bestehen. Inwiefern wir uns mit den dysfunktionalen Verhältnissen der Familie Lunies identifizieren, kann bestimmen, ob der gut dreistündige Film uns als lakonische Meditation oder aufgeplusterte Pseudopoesie trifft.

Glasner greift dieses Dilemma mit einem Augenzwinkern auf, als er Lars Eidingers Tom Lunies vom Konzept des „schmalen Grats“ erzählen lässt: Bei einem Kunstwerk stehe auf der einen Seite das künstlerische Bedürfnis nach ungetrübter Authentizität, auf der anderen Seite stünden die Interessen des Publikums. Neige sich das Werk zu sehr auf die eine Seite, drohe als Ergebnis unverständlicher Schlauberger-Kauderwelsch. Biedere sich der Künstler aber zu sehr dem Publikum an, generiere er flachen Kitsch für die Massen.
Wie ein Huhn ohne Kopf

Langsam kommt Lissy Lunies (Corinna Harfouch) in einem Geschmier aus ihrem eigenen Kot zur Besinnung, während ihr dementer Ehemann Gerd (Hans-Uwe Bauer) nackt durch die Wohnung irrt. Der Zerfall sickert in mehr als einer Hinsicht ins Haus Lunies. Zu ihren beiden Kindern Tom und Ellen (Lilith Stangenberg) hat Lissy kaum mehr Kontakt. Und Schuld daran hat – das finden wir bald heraus – maßgeblich sie selbst. Tom studiert gerade mit einem Orchester das Konzert seines depressiven Komponistenfreundes Bernard (Robert Gwisdek aka Käptn Peng) ein. Der Titel des Werkes: Sterben. Jedes Mal, wenn Toms Handy klingelt und der Name seiner Mutter auf dem Display erscheint, spannt sich der Körper des sanften Intellektuellen merklich an. In grimmiger Trance bewegt er sich durch sein Leben. Wie ein „Huhn, dem der Kopf abgeschlagen wurde, das aber trotzdem noch herumläuft“, erklärt ihm seine Affäre Ronja (Saskia Rosendahl).
Unsagbares in eine Form gießen

Sterben ist nach Glasners eigener Aussage sein persönlichstes Werk. Das ist leicht nachzuvollziehen – nicht nur daran gemessen, mit welcher Spezifik er die Figuren und Konflikte entwirft, sondern auch daran, wie er verschiedene Themenkomplexe miteinander vermengt. In dem Film ringt jede Figur auf ihre Weise damit, Schmerz in Sinn zu verwandeln. Tom, der als Künstlerfigur Glasner am nächsten steht, versucht das durch die Kunst. Die namensgebende Sinfonie, die von Glasners langjährigem Kollaborator Lorenz Dangel komponiert wurde, vertont auf berührende Weise das Ringen, Unsagbares in eine Form zu gießen. Die Szenen rund um die Proben bieten eine narrative Rahmung des Filmes, während Tom und Bernard ratlos über die Ausdünstungen ihrer überhitzten Hirne diskutieren.

Der ausgestellte Intellektualismus in Sterben wird unter anderem durch die einfache Bildsprache aufgefangen. Kameramann Jakub Bejnarowicz findet Kraft in der Simplizität, fängt Körper und Gesichter in langen, unaufgeregten Einstellungen ein. Diesen Raum füllen dann die drei Hauptdarsteller*innen, die ja alle auf ihre Weise eine gewisse Exzentrik besitzen - – allen voran Eidinger, dessen bohemische Verschrobenheit schon längst zum Selbstimage gehört, der aber hier zudem eine erfrischende Erdung besitzt. Harfouch ist nicht unvertraut mit der Rolle als harter, gefühlskalter Mutter. Bemerkenswert ist die Reue und Zerbrechlichkeit, die darunter hindurchschimmert. Es ist eine schlaue Entscheidung des Films, zuerst Lissys Perspektive einzunehmen. Dadurch verweigert er sich der erzählerischen Konvention, nach welcher der kantige Charakter später durch seine Hintergründe rehabilitiert wird. Lissys Hintergrund steht am Anfang. Damit ist sie zugleich verständlich und unerträglich, Antagonistin und Protagonistin in Glasners multiperspektivischer Erzählstruktur. Manchmal möchte man die sture Frau am Kragen schütteln, und doch können wir sie in ihrer Einsamkeit zumindest spüren. Zwischen Tom und Lissy spielt sich wohl eine der kraftvollsten Szenen ab: Beim Leichenschmaus für Gerd sitzen die beiden vor zwei Stücken Zwetschgenkuchen, als plötzlich die Worte wie bei einem Dammbruch aus Tom herausströmen. Er habe sich immer gefragt, warum sie so schreckliche Menschen seien. Und als Lissy die Plattitüden ausgehen, antwortet sie mit voller Ehrlichkeit.
Über das Trauma lachen

Lilith Stangenberg hat zuletzt in Robert Schwentkes Seneca (2023) ihre Affinität dazu gezeigt, ihre Figuren in dem Status einer gewissen geistigen Teilentrückung zu verorten. Auch Toms Schwester Ellen ist – immerhin aus freien Stücken – nie so ganz anwesend. Jede Nacht trinkt sie sich in den Hamburger Kneipen fast zum Exitus, am Tag verarbeitet sie auf der Arbeit ihren Kater – oder verkatert eher die Arbeit. Schließlich beginnt sie mit dem Zahnarzt Sebastian (Ronald Zehrfeld) eine leidenschaftliche, bald selbstzerstörerische Affäre. In diesen Momenten zeigt Glasner neben der Tragik einen absurden Hang zum Humor, wechselt vom Intellektualismus zum exzessiven Chaos. Ellens Charakterzeichnung droht beizeiten, karikaturistische Züge anzunehmen, doch zugleich verkörpert Ellen eben einen extremen, aber realistischen Punkt auf dem Spektrum der Vergangenheitsbewältigung. Eine der Intentionen Glasners liegt auch darin, Zugang zum Trauma durch Humor zu finden. Und sei es über so etwas wie das Borderline-Syndrom.
In Kreisen um Kreise

Besitzt der Film trotzdem einen Funken Optimismus im Blick auf das Leben? Da hält er sich mehrdeutig. „Die Hoffnung steckt nicht im Stück“, ruft der Komponist Bernard erbost, als ein Violinist seine Komposition dafür kritisiert, nur Pessimismus auszudrücken, „die Hoffnung steckt darin, dass wir es spielen.“ Anfänglich scheint diese Aussage prätentiös. Doch es steckt wirklich eine Katharsis in der Fähigkeit, über den Tod zu lachen, die Schönheit im Leid zu erkennen, zu verstehen, dass wir in unserer Einsamkeit ironischerweise nicht alleine sind. So liegen am Ende des Films ein freiwilliger Tod und eine unfreiwillige Schwangerschaft direkt nebeneinander, und der Zyklus scheint sich zu wiederholen. Sterben dreht sich in Kreisen um Kreise.
Neue Kritiken

Douglas Gordon by Douglas Gordon

If Pigeons Turned to Gold

Don't Come Out

Dead of Winter - Eisige Stille
Trailer zu „Sterben“


Trailer ansehen (2)
Bilder


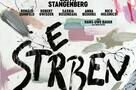

zur Galerie (8 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Tom Pisa
Schöne Kritik und "aufgeplusterte Pseudopoesie" ist eine gute Beschreibung für diesen Film.
Claudia Roth, Iris Berben und Veronika Ferres sollen "Emotionale Tiefe" erkannt haben.
Mein Vorschlag wäre Wohlstandspathos.


















1 Kommentar