Die wilde Zeit – Kritik
Lichterlohe Funken der Revolution. Olivier Assayas stürzt sich ins Herz des Jahres 1971 und liefert sein nächstes Meisterwerk.

Vor kurzem waren Gilles (Clément Métayer) und Laure (Carole Combes) noch ein Paar, jetzt treffen sie sich am Rande einer Party wieder. Er zeigt ihr seine neueren Zeichnungen, sie wählt eine aus. Er steht auf und hält das Bild an eine Kerze: „Es war für dich, und du hast es gesehen. Kein anderer soll es mehr sehen.“ In Olivier Assayas’ Post-68er-Film Die wilde Zeit (Après Mai) brennt es immer wieder. Wie hier verbinden sich oft romantische Geste und revolutionärer Akt. Assayas’ Protagonisten sind Anarchisten, Trotzkisten, Maoisten, Situationisten. Im Zentrum ihres Lebens steht das Streben nach einem gesellschaftlichen Wandel – und die Kunst. Sie sind Jugendliche, gerade noch Schüler oder gerade nicht mehr. Die gescheiterte Revolution vom Mai 1968 ist keine ferne Erinnerung, sondern erst ein paar Jahre her. Dennoch vergeudet keiner darüber ein Wort, alle Blicke sind auf die Gegenwart gerichtet. Was hier und jetzt verändert werden muss, dafür wird gekämpft.

Wenn Gilles und seine Freunde einen Container anzünden oder eine Straßenschlacht mit einer Barrikade aus Flammen gewinnen, dann entspringt das einer Notwendigkeit. Wenn ein Heuhaufen brennt oder gleich ein ganzes Haus in den Augen von Laure, dann beginnt die Entpolitisierung langsam um sich zu greifen. Wenn am Schluss ein Tatfahrzeug angezündet wird für „die Kohärenz mit sich selbst“, dann ist der Junge mit den braunen Haaren im Gesicht erstmals nicht mehr Gilles. Dann hat er bereits die Fackel übergeben. Und dennoch brennt das Auto lichterloh.
Das größte Übel an Historienfilmen ist die Tendenz, die Zeit als abgeschlossene Episode zu begreifen, auf die lediglich im Medium einer Lektion oder gefolgerten Einsicht zurückgegriffen wird. Olivier Assayas macht das genaue Gegenteil: Er taucht ein in die Zeit und in ihre mit vollem Ernst ausgetragenen Konflikte. Und wir werden einfach hineingeworfen in die hitzigen Diskussionen, die sich zuerst als Fetzen einer unbekannten Fragestellung präsentieren, als Antworten auf die Aktualität im ideologisch genährten Geiste. Nur nach und nach erfassen wir die Komplexität der verschiedenen Lager und ihrer Protagonisten, denn nie werden sie heruntergebrochen. Mal wirken sie naiv oder verbrämt, mal absurd und komisch.
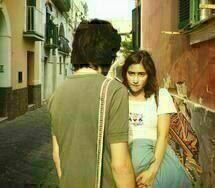
Die wilde Zeit ist nicht subjektiv im Sinn einer eingeschränkten Perspektive, aber doch insofern der Blick hier stets gegenwärtig und forschend ist. Assayas’ größtes Talent, das Einfangen einer berstenden Lebendigkeit – das er bereits in Filmen wie Irma Vep (1996) und Ende August, Anfang September (Fin août, début septembre, 1998) zur Vollendung brachte –, kommt hier erneut zur Entfaltung. Allerdings nicht mit dem sonst oft rauschhaften Wirbel, den in seinen Filmen vor allem die Frauen anrichten. In Die wilde Zeit funkeln die Figuren eher – wie beseelt von ihren Überzeugungen. Da geht Assayas’ Konzept vollkommen auf, in Erinnerung an seine Inspiration durch Bresson fast ausschließlich auf Laiendarsteller zu vertrauen, die er nach ihrer Nähe zu den Figuren besetzt hat.
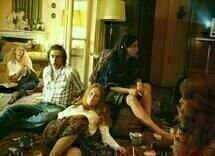
Die Melancholie über die vergangene Zeit ist den Bildern über die 1970er Jahre kaum auszutreiben. Obwohl Die wilde Zeit zu keinem Zeitpunkt ein Abgesang ist, schleicht sich doch eine Form der zugleich fröhlichen und schmerzlichen Rückschau hinein, zumindest im Auge des heutigen Betrachters, dass man sich bei allem Anachronismus einzelner Konzepte die Substanz des Widerstands gegen vorherrschende Genügsamkeit und Ungerechtigkeit zurücksehnt. In dieser Hinsicht ist der neue Assayas nicht nur eine Verlängerung seines Spielfilms L’eau froide (1994), wie der Regisseur das Projekt selbst beschreibt, sondern auch ein entfernter Verwandter von Philippe Garrels Meilenstein der 68er-Filme Les amants réguliers (2005). Obwohl Garrel stilistisch kaum unterschiedlicher sein könnte, ist beiden Filmen ihr Bemühen gemein, die damalige Zeit für sich selbst sprechen zu lassen und es in einer Kombination aus Infragestellung und sanfter Überhöhung dem Zuschauer zu überlassen, sich neu zu positionieren. Der treibende Soundtrack vom Psychedelic Rock eines Syd Barrett über experimentelle, in den Jazz hineinreichende Kompositionen von Soft Machine bis zum dissonanten Blues von Captain Beefheart trägt entscheidend dazu bei, dass eine Nähe zur über 40 Jahre alten Vergangenheit denk- und fühlbar wird. Wenn eine Emphase mit den Songs der Zeit möglich ist, dann vielleicht auch mit deren Ideen? Die Staffelübergabe von Gilles ist insofern auch an uns gerichtet. So viel Agitprop muss sein.

In einer für den autobiografisch geprägten Film entscheidenden Stelle debattiert Gilles’ Freundin Christine mit mehreren Filmemachern darüber, ob revolutionäre Filme nicht auch einer revolutionären Form bedürften. „Wir machen keine Filme für Ästheten“, ist die schnippische Antwort des einen. Ein anderer hält der Kritik an ihrem klassischen Ansatz entgegen, dass deren Gegenteil, nämlich stilistischer Individualismus, der Weg des kleinen Bürgertums sei. Kurz darauf trennen sich Christine und Gilles, und sie folgt dem Team zu ihrem nächsten Dreh. Als sich die beiden einige Zeit später wieder treffen, will er von ihr wissen, ob der Film fertig geworden ist. „Wir debattieren noch. Manche Kameraden finden ihn politisch fragwürdig.“ Und obwohl sich auch der junge Assayas als Gilles noch bemüht, der politischen Tragweite seiner Arbeit habhaft zu werden, sehen wir ihn wenig später bei einem B-Movie-Dreh mit Nazis, Monstern und einer fast nackten Frau. Dass die Zukunft nicht nur eine der Resignation ist, dafür ist Die wilde Zeit der beste Beweis. Über den Impressionismus rettet das Kino die Ideologie.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Die wilde Zeit“



Trailer ansehen (3)
Bilder




zur Galerie (14 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.













